Dass auch große Büchereien eine soziale und vermittelnde Funktion wahrnehmen können, wird in diesem Artikel des Standards vom 14.12.07 gezeigt. Es hat sich erwiesen, dass die Wahl des Standortes (von Verslumung bedrohte Gürtelregion) sich konstitutiv für die Bibliotheksarbeit erwies und damit auch für sogenannte bildungsferne Schichten ein niedrigschwelliger Zugang möglich wurde. Was ohne die Bereitschaft der BibliothekarInnen, sich auch schwierigen und nervenanspannenden Situationen auszusetzen, nicht möglich wäre. Dass die Anerkennung dafür durch den Dienstgeber sich in Grenzen hält, eint diese Bediensteten mit ihren KollegInnen der Zweigstellen, siehe >>>
Tagasyl Bücherei
An die 3.500 Menschen besuchen täglich die Wiener Hauptbücherei - Dass der Migrantenanteil gefühlte 50 Prozent beträgt, liegt nicht allein an der geografischen Lage
Verliebte Blicke und leises Lachen zwischen den meterhohen Bücherregalen. Das etwa 17-jährige Mädchen beugt sich zu ihrem, ungefähr gleichaltrigen Begleiter. Er flüstert in ihr Ohr, sie schüttelt kichernd den Kopf. Das enggebundene fliederfarbene Kopftuch ist verrutscht. An der linken Schläfe hängt eine schwarze, gelockte Haarsträhne hervor. Die Frage, ob sie oft hierher kommen, unterbricht den scheuen Flirt abrupt. Die beiden rücken schlagartig voneinander ab. Während der Bursche verlegen sein weißes Ed-Hardy-Baseballcap zurecht schiebt und erklärt, sie wollen nicht gestört werden - nein, sie wollen nicht sagen weshalb und wie oft sie in die Hauptbücherei kommen - zupft das Mädchen mit abgewandtem Gesicht ihr Kopftuch zurecht. Danach herrscht betretenes Schweigen. Erst einige Minuten später sieht man die beiden durch die Glaswand der Leseecke wieder lachen.
Die städtische Hauptbücherei am Urban-Loritz-Platz liegt an der Grenze zwischen dem siebten und dem fünfzehnten Wiener Gemeindebezirk. Bürgertum und Bobos auf der einen, mit 35,8 Prozent höchster Ausländeranteil Wiens auf der anderen Seite des Gürtels. Das Publikum in der Bücherei ist dementsprechend gemischt: neben österreichischen Studenten würden auch viele Asylwerber und Migranten kommen, sagt Christian Jahl, Leiter der Bücherei.
Geheimer Treffpunkt
Manche der Jugendlichen aus Migrantenfamilien sind offenbar nicht der Bücher wegen hier. Es sind Mädchen aus streng muslimischen Familien, die die Bücherei als heimlichen Treffpunkt nutzen. Nach islamischem Brauch können sie Bibliotheken ohne männliche Begleitung besuchen. "Die Mädchen werden oft von ihren Brüdern oder Vätern gebracht und abgeholt", sagt Jahl. Hier finden sie ein Stück Freiraum zwischen den Lesenden, Internetsurfenden und Musikhörenden. "In der Bücherei können sie sich in Ruhe mit Freundinnen und Freunden treffen und an den Computern chatten. In Internetcafes fühlen sie sich beobachtet und unwohl; sich im Kaffeehaus zu verabreden ist schwierig", sagt Meltem Weiland, Frauenberaterin des Verein "Orient Express". Zwar sind ihr in ihrem Arbeitsalltag in der Migrantinnenberatung derartige Beispiele bisher nicht untergekommen, sie wisse aber aus Erzählungen dass Büchereien für die Mädchen ein beliebter Treffpunkt seien.
Jagdrevier Internetgalerie
"Die Internetgalerie ist so etwas wie eine Anbahnungsplattform", erzählt Christian Jahl. Nach der Bibliothekseröffnung im Oktober 2003 gab es häufig Beschwerden: die Migrantenkinder seien zu laut, viele Besucher fühlten sich gestört, manche Frauen belästigt. Jahl reagierte, indem er die 20 Internet-PCs in einen eigenen Bereich, durch eine Glastür vom Lesesaal getrennt, verlegten ließ und vier zusätzliche Computer anschaffte, die nur für Frauen reserviert sind. Seitdem herrscht Frieden.
"Viele dieser Jugendlichen sind zum ersten Mal in einer Bibliothek. Die meisten kommen wegen dem Internetzugang. Viele entdecken hier auch andere Medien für sich." Jahl bemüht sich, den fremdsprachigen Besuchern etwas zu bieten: in der Hauptbücherei stehen jeweils an die 1.000 Bücher in türkischer, polnischer, slowenischer, russischer und persischer Sprache.
Kleine Wohnungen, viel Lärm
Beziffern kann Jahl den Ausländeranteil unter den Besuchern nicht, da einerseits die Herkunft der Kunden bei der Einschreibung nicht erfasst werde. Andererseits würden viele der täglich an die 3.500 Besucher über keine Entlehnkarte verfügen, sondern nur die kostenlosen Angebote nutzen: internationale Tageszeitungen lesen, oder lernen. Besonders Kinder von Migranten würden in der Hauptbücherei gerne Aufgaben machen und lernen. "Oft sind die Wohnungen winzig, die Zimmer müssen sie mit vielen Geschwistern teilen. Da kann man sich nur schwer konzentrieren."
Im "College Kirango", der Abteilteilung für Kinderbücher sitzen in einer abgelegenen Ecke zwei junge Muslimas. Auf dem Tisch vor ihnen einige Hefte und Bücher ausgebreitet, die Gesichter tief darüber gebeugt und völlig ins Lernen versunken. Sie tippen Zahlen in ihre Taschenrechner und diskutieren mit gedämpften Stimmen. Die Mädchen sind ungefähr 15 Jahre alt, tragen ordentlich sitzende Kopftücher und haben trotz der hohen Raumtemperatur ihre langen braunen Mäntel nicht ausgezogen. Auch sie wollen nicht von sich erzählen. "Keine Zeit", sagt eine der beiden, lächelt schüchtern und winkt abwehrend mit den Händen. Die andere starrt beharrlich in ihr Heft, als sei jede Sekunde in der Bücherei kostbar.
Wohnzimmer für Heimatlose
Neben den ausländischen Studenten, den lernenden Schülern und den Jugendlichen, die die Bibliothek zum Zeitvertreib und als Treffpunkt besuchen, fällt eine weitere Gruppe auf: Jene, für die die Bücherei Wärmestube und Wohnzimmer ist. Wenigstens innerhalb der Öffnungszeiten. In den breiten, gepolsterten Armsesseln nahe dem Eingangsbereich, dort wo die internationalen Zeitungen und Magazine aufliegen, haben es sich einige Männer gemütlich gemacht. Die Mantelkrägen hochgeschlagen, die Beine auf ihren Taschen ruhend, dösen sie vor sich hin: die zerfurchten Gesichter entspannt, eine Zeitung auf dem Schoß. Abschalten vom aufreibenden Leben auf der Straße. In der Bücherei ist jeder willkommen, so lange er sich an die Hausordnung hält. Warum es kaum Probleme gibt, erklärt Christian Jahl so: "Wenn sich Menschen an einem Ort wohl fühlen, dann geben sie darauf acht, dass es so bleibt, dass nichts zerstört wird." (Birgit Wittstock, derStandard.at, 13.12.2007)
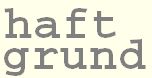
Trackback URL:
https://haftgrund.twoday.net/stories/4534488/modTrackback