Eigentlich sind es zwei Themen, doch wie es der Teufel will, vereinen sie sich in diesen Tagen zu einem gemeinsamen.
1)
Noch Anfang der 70er mussten jene Menschen, welche die Schwellenstarre vor Wiener Städtischen Büchereien zu überwinden vermochten, zum Zwecke der Einschreibung nicht nur einen Lichtbildausweis und einen Meldezettel vorlegen, sondern auch ihren Beruf - bei Frauen den Beruf des Mannes - angeben. Mitte der 70er setzte sich bei den BibliothekarInnen die Auffassung durch, dass sie eigentlich der Beruf ihrer Leser nichts anging und der Beruf der Ehemänner ihrer Leserinnen schon gar nichts. Das Einschreibformular wurde entsprechend vereinfacht. Auf den Lichtbildausweis wurde zumeist verzichtet, da der Meldezettel ohnehin alle benötigten Angaben enthielt und nicht anzunehmen war, dass jemand sich zum Zwecke der Erschleichung einer Mitgliedschaft bei den Städtischen Büchereien einen fremden Meldezettel aneignete.
Natürlich gab es Büchereien, in welchen die Vorschriften buchstabengetreu umgesetzt wurden, was manch hoffnungsvoller Hinauflese-Laufbahn schon vor ihrem Beginn ein jähes Ende setzte, weil es - auch angesichts der sparsamen Öffnungszeiten - nicht immer zu einem zweiten Büchereieinschreibeversuch reichte.
Aber im Großen und Ganzen wurden die Einschreibungen lockerer gehandhabt, und die potentiellen LeserInnen zumeist als so vertrauenswürdig angesehen, dass man sie auch ohne vollständige Unterlagen in die überschaubare Gemeinschaft der eingeschriebenen BüchereibenutzerInnen aufnahm.
Mit der Änderung des Meldegesetzes 2002 wurde der Meldezettel hinfällig und es musste die Entscheidung getroffen werden, ob ein Lichtbildausweis, mit dem man innerhalb Europas über alle Grenzen gelassen wird, auch für eine Mitgliedschaft bei den Büchereien Wien ausreicht.
Wie zu erwarten, wurde weiter auf die behördliche Kontrolle der Adressangaben bestanden.
Das hieß, bei jeder Einschreibung eine Abfrage des Zentralmelderegisters via Internet zu tätigen.
Alle Abfragen werden vom System protokolliert und jährlich erfolgt eine stichprobenweise Überprüfung, ob ein Missbrauch betrieben wurde.
Der Datenschutzbeauftragte der Abteilung muss dann die Abfragen auf Stimmigkeit überprüfen und die Bediensteten müssen allenfalls erklären, zu welchem Zweck sie eine Monate zurückliegende Abfrage gemacht haben, wenn z.B. die Nummer der Lesekarte nicht genau übereinstimmt.
Damit sind die Büchereibediensteten unversehens von Kontrollierern zu Kontrollierten geworden.
2)
Wie bereits berichtet, zählen die Datenleitungen der Büchereien nicht zu den schnellsten, und Anfang des 21. Jahrhunderts waren sie noch langsamer als jetzt, der ZMR-Server ist ebenfalls keine Blitzkneisser, also dauerte es zumeist eine geraume Zeit, bis die Bestätigung erfolgen konnte, dass die angegebene Adresse mit der im ZMR identisch ist.
Ein weiteres Hindernis auf dem Weg zur Nutzung der Angebote der Büchereien ist die mangelnde Datenqualität im Register. Es kamen immer wieder Fälle vor, dass künftige LeserInnen mehrfach beteuerten, dass ihre Angaben richtig seien und die im ZMR fehlerhaft.
Je nach der inneren Größe und der Bereitschaft der BibliothekarInnen, die Vorschriften allenfalls als Diskussionsvorschlag aufzufassen, wurden auch solche mit Datenmakel behaftete Menschen eingeschrieben. Oder eben nicht.
Diese Prozedur konnte in all ihren Facetten in den Wochen und Monaten nach der Eröffnung der Hauptbücherei 2003 beobachtet werden, als eine unverhofft hohe Zahl von WienerInnen Mitglieder der Büchereien Wien werden wollten.
Die dadurch entstehenden langen Schlangen wurden beileibe nicht kürzer durch die vorgeschriebenen ZMR-Abfragen.
Dabei gab es unterschiedliche Herangehensweisen durch die Bediensteten:
- Die Bibliokraten machten jede Einschreibung zu einem hochnotpeinlichen Verhör, das nur jene erfolgreich überstanden, deren Angaben mit denen des Zentralmelderegisters i-tüpfelchenmäßig übereinstimmten.
- Die gemäßigten Legalisten lavierten sich durch und entschieden nach Gefühl und Sympathie. Wie immer. Manche wurden wieder weggeschickt, die meisten aber eingeschrieben, oft mit einem Vermerk - "... wird nachgebracht"
- Und die Biblioanarchas verzichteten von vornherein auf die Abfrage, da sie der Meinung waren, dass nicht von vornherein Betrug durch die sich Anmeldenden anzunehmen sei.
Jede dieser biblioideologischen Tendenzen umfasste ca. 1 Drittel der in der Einschreibung Tätigen. Wodurch es auch zu unterschiedlichen Einschreibgeschwindigkeiten kam und geübte Schlangensteher bald herausfanden, wo es sich lohnte, sich anzustellen.
3)
Einige Zeit nach den Einschreibanstürmen der Hauptbücherei kam die zentrale Mitteilung, dass es ab nun nicht mehr notwendig sei, bei jeder Einschreibung das ZMR abzufragen, sondern nur in Zweifelsfällen und bei unzustellbaren Mahnfällen.
Man könnte sagen, das anarchistische Modell hat sich auch hier als das praxisnächste erwiesen, leider wurde es im Fall der Hauptbücherei reichlich spät gewählt. Eine alte Erfahrung.
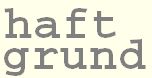
Trackback URL:
https://haftgrund.twoday.net/stories/4825463/modTrackback