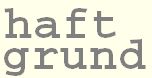Naturgemäß nur in eigener Aktivität
und wieder ein naturgemäß frei erfundenes Mailolett:
"dieses Jahr beginnt mit einer vehementen Rasanz an Andrang und Nachfrage, sodass wir in allen Bereichen an unsere Grenzen vorgedrungen sind (nicht zuletzt durch einige Ausfälle)."
"Herzlichen Dank an alle MitarbeiterInnen an dieser Stelle für den permanenten Dienst am Kunden, für den Einsatz und das fabelhafte Know-How!!!"
"Nebenbei sind die Kisten laufend knapp, da wir in Rückgaben und Ringleihe fast untergehen, auch hier ist jede Hilfestellung willkommen"
"heute sind es schon soviele Bücherwagen, daß wir nicht mehr wissen wohin damit. Bitte dringend abräumen."
"Die Kollegen aus dem Sortierraum sind mit den Rückgaben aus der Bücherei voll ausgelastet."
"es sind nicht die fehelenden [sic!] Kisten, es ist die Menge der Medien, die retourniert werden. Mit meinen wenigen, fleissigen Mitarbeitern ist das nur langsam abbaubar"
"dieser Riesenandrang hat auch verursacht, dass im Eingangsbereich ein massiver Rückstau an Einstellmengen (in Form dutzender uneingestellter Bücherwagen) vorhanden ist!"
"Zudem stapeln sich die Kisten der Ringleihe zwischen den Liften, Viele Bücherwagen stehen bis zum Büro und die meisten Kisten können nicht ausgeräumt werden, weil die dementsprechenden Kisten für die Ringleihe fehlen."
"Ich ersuche in diesem Zusammenhang um Hilfestellung von Seiten der Leitung der Büchereien, um dieses Nadelöhr beheben zu können."Eine so kurzfristige Hilfestellung kann
naturgemäß
nur in eigener Aktivität liegen;
ich ersuche daher diejenigen zentralen
MitarbeiterInnen - die derzeit allerdings
auch gar nicht viele sind - nach
Maßgabe ihrer Möglichkeiten am Vormittag
beizustehen. Ich
werde das auch tun.
Als p.s. eine vermutlich unnötige Anmerkung, die doch gemacht werden soll:
naturgemäß
sind sämtliche sonstigen anwesenden Mitarbeiter angewiesen, sich der Hilfsaktion anschließen.
"herzlichen Dank für die solidarische Hilfe!!
Ich denke, ich habe seit der Eröffnung noch nie einen derart starken Andrang zu Jahreswechsel erlebt."
"Ein Problem, das offen bleibt, sind die fehlenden Ringleihekisten, ohne diese können wir den Rückstau in der Ringleihe nicht abarbeiten."