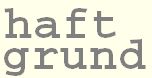Diefenbach-Interview
Im Falter 38/06 schafft es Katja Diefenbach in wenigen Sätzen nicht nur die 68er-Aporie zu benennen, sondern auch die leidigen Hoffnungen der Postoperaiisten als teleologische zu kennzeichnen. Das Interview hat Robert Misik geführt. Am 28. September führen er und Katja Diefenbach ein Gespräch im Kreisky-Forum .
Falter: Kann man heute noch politisch aktiv sein? Die Rebellenpose ist doch nur mehr Zitat, noch dazu ein kommerzialisiertes. Gibt es einen Ausweg aus der Peinlichkeit?
Diefenbach: Peinlichkeit ist eigentlich eine interessante Geste; und ich frage mich, ob es überhaupt möglich ist, politisch zu sein, ohne peinlich zu werden. Gegenüber der Normalisierung und der Katastrophe, dass alles so weitergeht, ist die Geste des Politischen an sich störend und deplatzierend. Genau deshalb ist der souveräne Zyniker ein herrschendes role model Er verkörpert ein Subjekt, das noch über die Ungerechtigkeiten kapitalistischer Vergesellschaftung im Bilde ist, den Glauben an grundsätzliche Veränderungen aber für idealistisch, lächerlich oder terroristisch hält und stattdessen lieber den Kapitalismus in seiner freisetzenden Bewegung affirmiert. Denn der Kapitalismus ist für ihn der große Möglichmacher, ein System schöpferischer Zerstörung, in dem sogar abweichende Lebensformen und subkulturelle Praktiken, wenn sie sich verwerten lassen, zugelassen und verstärkt werden können.
Falter: Das zeigt aber immerhin, dass die Abweichung, die Dissidenz und das fröhliche Dagegensein gar nicht so subversiv sind. Damit kann der Kapitalismus prima leben.
Diefenbach: Natürlich, der Kapitalismus und bio-politische Regierungsstrategien antizipieren Widerstandsformen und versuchen, sie produktiv zu machen. Von daher rührt die Kritik politischer Theoretiker wie Slavoj Zizek oder Alain Badiou, dass die leere Universalität des Kapitals mit partikularer Identität jedwelcher Art ausgezeichnet koexistiert: Identität verspricht Halt und imaginäre Gemeinschaftlichkeit in der Geschwindigkeit abstrakter Verwertung; Identitäten vermehren die Konsumtionsmöglichkeiten etc. Zizek und Badiou verwechseln allerdings minoritäre Politik mit ihrem Scheitern. Die minoritären Revolten der Sechziger- und Siebzigerjahre waren ein politisches Ereignis. Sie haben mit der autoritären Linie in der Linken gebrochen, mit dem Kaderprinzip, dem Leninismus, der Reduzierung des Politischen auf Strategie- und Taktikdenken. Das Politische kann seit- dem an jedem Ort und in jedes Verhältnis intervenieren. Es erfordert die Praxis von vielen.
Falter: Die Kritik von Zizek oder Badiou, die Sie anführen, muss deswegen aber doch nicht ganz falsch sein.
Diefenbach: Die These, dass kapitalistische Verwertung und Identitätspolitik sich gegenseitig stabilisieren, halte ich nicht für falsch, im Gegenteil, nur die politische Konsequenz. Was folgert man daraus, dass die minoritären Kämpfe einen enormen Schub sozialer, politischer und sexueller Differenzierung bewirkt haben, ohne zu grundlegenden gesellschaftlichen Veränderungen wie sozialistischer Selbstverwaltung geführt zu haben? Was bedeutet es, dass die minoritären Kämpfe in diesem Sinne erfolgreich gescheitert" sind? Man muss nach den gefährlichen Übergängen zwischen minoritären Praktiken, kapitalistischen Reintegrationen und der Kommerzialisierung dissidenter Lebensformen suchen. Aber auch wenn Kämpfe scheitern, sind sie nicht verloren. Unvergessen ist, wovon minoritäre Praktiken sich abgewandt haben, vom soldatischen, moralischen und disziplinatorischen Erbe linker Politik.
Falter: Ist das nicht sehr rosarot gedacht? Man erzählt etwas, was man auch als Geschichte des Scheiterns erzählen kann, eben als Geschichte des Erfolges.
Diefenbach: Jeder politische Kampf steht in der Ge- fahr zu scheitern, sei es durch Integration, durch Repression oder durch Zer- "Viele Akteure der 68er- Revolten haben sich integriert. Was heißt das?' fall. Das soll nicht das Scheitern ver- harmlosen, sondern das Denken von Sieg und Niederlage beenden. Viele Akteure der 68er-Revolten haben sich integriert, die autonomen Bewegungen haben sich in den Achtzigerjahren in subkultureller Kleingruppenmilitanz selbst blockiert. Aber was heißt das? Ein Theoretiker wie Antonio Negri geht zum Beispiel davon aus, dass der Übergang in den Postfordismus mit einer derart selbstorganisierten Subjektivierungsform einhergegangen ist, dass der Sprung in ein kommunistisches Projekt potenziell kurz bevorsteht. Das impliziert viele optimistische Voran- nahmen - von den Kämpfen als Motor der Geschichte, vom Kapitalismus, der den Keim seiner Überwindung in sich trägt, bis hin zur Vorstellung vom be- freienden Tätigkeitsvermögen der Menge. Eine gefährliche Form, über den "Erfolg" der Kämpfe zu sprechen.
Falter: Auch wenn man sich darauf einigt, dass der Kapitalismus durch Kämpfe, Widerspruch, was weiß ich, verändert wurde - nicht alle wären so überzeugt, dass er zu seinem Vorteil verändert wurde.
Diefenbach: Genau. Ich werde den Eindruck nicht los, dass zwei antikapitalistische Erzählweisen mit ihren je eigenen Reduktionismen im Umlauf sind. Die eine geht davon aus, dass sich im Über- gang zum Postfordismus das Kampfniveau erhöht hat, weil die gesellschaftliche Regulation in einem solchen Aus- maß auf der biopolitischen Selbstregierung der Leute beruht, dass diese ganz bald auf die Idee kommen könnten, den Kapitalismus abzuschütteln. Auf der anderen Seite gibt es den romantischen Antikapitalismus, der Verlust, Entfremdung, Verfall diagnostiziert.
Falter: Welche politischen Praktiken haben denn heute das Zeug dazu, erfolg- reich zu scheitern?
Diefenbach: Ich rede nicht dem erfolgreichen Scheitern das Wort, sondern der Potenzialität von Erfahrungen und einer gewissen Möglichkeit, mit ihnen etwas anzufangen. In den letzten Jahren sind einige interessante politische Aktions- formen entstanden. Ich denke an das Auftauchen der Zapatisten in Mexiko, die eine Guerilla ohne Militarismus erfunden haben, an demokratisierte Militanzvorstellungen, mit denen vom Pathos der spontanen Aktion und der vereinzelten Eskalation abgerückt wurde, an die Vorstellung, dass das Politische ein asubjektives Gefüge ist, von "In den letzten Jahren sind einige interessante Aktionsformen entstanden" dem aus an vielen Stellen interveniert wird, und auch an die Vorstellung, dass politischer Aktivismus mit Vorsicht zu genießen ist, weil er die Gefahr in sich birgt, sich mit dem zu verwechseln, was im Eifer und Weitermachautomatismus von wenigen endet.
Falter: Kann man heute noch politisch aktiv sein? Die Rebellenpose ist doch nur mehr Zitat, noch dazu ein kommerzialisiertes. Gibt es einen Ausweg aus der Peinlichkeit?
Diefenbach: Peinlichkeit ist eigentlich eine interessante Geste; und ich frage mich, ob es überhaupt möglich ist, politisch zu sein, ohne peinlich zu werden. Gegenüber der Normalisierung und der Katastrophe, dass alles so weitergeht, ist die Geste des Politischen an sich störend und deplatzierend. Genau deshalb ist der souveräne Zyniker ein herrschendes role model Er verkörpert ein Subjekt, das noch über die Ungerechtigkeiten kapitalistischer Vergesellschaftung im Bilde ist, den Glauben an grundsätzliche Veränderungen aber für idealistisch, lächerlich oder terroristisch hält und stattdessen lieber den Kapitalismus in seiner freisetzenden Bewegung affirmiert. Denn der Kapitalismus ist für ihn der große Möglichmacher, ein System schöpferischer Zerstörung, in dem sogar abweichende Lebensformen und subkulturelle Praktiken, wenn sie sich verwerten lassen, zugelassen und verstärkt werden können.
Falter: Das zeigt aber immerhin, dass die Abweichung, die Dissidenz und das fröhliche Dagegensein gar nicht so subversiv sind. Damit kann der Kapitalismus prima leben.
Diefenbach: Natürlich, der Kapitalismus und bio-politische Regierungsstrategien antizipieren Widerstandsformen und versuchen, sie produktiv zu machen. Von daher rührt die Kritik politischer Theoretiker wie Slavoj Zizek oder Alain Badiou, dass die leere Universalität des Kapitals mit partikularer Identität jedwelcher Art ausgezeichnet koexistiert: Identität verspricht Halt und imaginäre Gemeinschaftlichkeit in der Geschwindigkeit abstrakter Verwertung; Identitäten vermehren die Konsumtionsmöglichkeiten etc. Zizek und Badiou verwechseln allerdings minoritäre Politik mit ihrem Scheitern. Die minoritären Revolten der Sechziger- und Siebzigerjahre waren ein politisches Ereignis. Sie haben mit der autoritären Linie in der Linken gebrochen, mit dem Kaderprinzip, dem Leninismus, der Reduzierung des Politischen auf Strategie- und Taktikdenken. Das Politische kann seit- dem an jedem Ort und in jedes Verhältnis intervenieren. Es erfordert die Praxis von vielen.
Falter: Die Kritik von Zizek oder Badiou, die Sie anführen, muss deswegen aber doch nicht ganz falsch sein.
Diefenbach: Die These, dass kapitalistische Verwertung und Identitätspolitik sich gegenseitig stabilisieren, halte ich nicht für falsch, im Gegenteil, nur die politische Konsequenz. Was folgert man daraus, dass die minoritären Kämpfe einen enormen Schub sozialer, politischer und sexueller Differenzierung bewirkt haben, ohne zu grundlegenden gesellschaftlichen Veränderungen wie sozialistischer Selbstverwaltung geführt zu haben? Was bedeutet es, dass die minoritären Kämpfe in diesem Sinne erfolgreich gescheitert" sind? Man muss nach den gefährlichen Übergängen zwischen minoritären Praktiken, kapitalistischen Reintegrationen und der Kommerzialisierung dissidenter Lebensformen suchen. Aber auch wenn Kämpfe scheitern, sind sie nicht verloren. Unvergessen ist, wovon minoritäre Praktiken sich abgewandt haben, vom soldatischen, moralischen und disziplinatorischen Erbe linker Politik.
Falter: Ist das nicht sehr rosarot gedacht? Man erzählt etwas, was man auch als Geschichte des Scheiterns erzählen kann, eben als Geschichte des Erfolges.
Diefenbach: Jeder politische Kampf steht in der Ge- fahr zu scheitern, sei es durch Integration, durch Repression oder durch Zer- "Viele Akteure der 68er- Revolten haben sich integriert. Was heißt das?' fall. Das soll nicht das Scheitern ver- harmlosen, sondern das Denken von Sieg und Niederlage beenden. Viele Akteure der 68er-Revolten haben sich integriert, die autonomen Bewegungen haben sich in den Achtzigerjahren in subkultureller Kleingruppenmilitanz selbst blockiert. Aber was heißt das? Ein Theoretiker wie Antonio Negri geht zum Beispiel davon aus, dass der Übergang in den Postfordismus mit einer derart selbstorganisierten Subjektivierungsform einhergegangen ist, dass der Sprung in ein kommunistisches Projekt potenziell kurz bevorsteht. Das impliziert viele optimistische Voran- nahmen - von den Kämpfen als Motor der Geschichte, vom Kapitalismus, der den Keim seiner Überwindung in sich trägt, bis hin zur Vorstellung vom be- freienden Tätigkeitsvermögen der Menge. Eine gefährliche Form, über den "Erfolg" der Kämpfe zu sprechen.
Falter: Auch wenn man sich darauf einigt, dass der Kapitalismus durch Kämpfe, Widerspruch, was weiß ich, verändert wurde - nicht alle wären so überzeugt, dass er zu seinem Vorteil verändert wurde.
Diefenbach: Genau. Ich werde den Eindruck nicht los, dass zwei antikapitalistische Erzählweisen mit ihren je eigenen Reduktionismen im Umlauf sind. Die eine geht davon aus, dass sich im Über- gang zum Postfordismus das Kampfniveau erhöht hat, weil die gesellschaftliche Regulation in einem solchen Aus- maß auf der biopolitischen Selbstregierung der Leute beruht, dass diese ganz bald auf die Idee kommen könnten, den Kapitalismus abzuschütteln. Auf der anderen Seite gibt es den romantischen Antikapitalismus, der Verlust, Entfremdung, Verfall diagnostiziert.
Falter: Welche politischen Praktiken haben denn heute das Zeug dazu, erfolg- reich zu scheitern?
Diefenbach: Ich rede nicht dem erfolgreichen Scheitern das Wort, sondern der Potenzialität von Erfahrungen und einer gewissen Möglichkeit, mit ihnen etwas anzufangen. In den letzten Jahren sind einige interessante politische Aktions- formen entstanden. Ich denke an das Auftauchen der Zapatisten in Mexiko, die eine Guerilla ohne Militarismus erfunden haben, an demokratisierte Militanzvorstellungen, mit denen vom Pathos der spontanen Aktion und der vereinzelten Eskalation abgerückt wurde, an die Vorstellung, dass das Politische ein asubjektives Gefüge ist, von "In den letzten Jahren sind einige interessante Aktionsformen entstanden" dem aus an vielen Stellen interveniert wird, und auch an die Vorstellung, dass politischer Aktivismus mit Vorsicht zu genießen ist, weil er die Gefahr in sich birgt, sich mit dem zu verwechseln, was im Eifer und Weitermachautomatismus von wenigen endet.