In
Beamte. Wirtschafts- und sozialgeschichtliche Aspekte des k.k. Beamtentums" von
Karl Megner wird auch auf das Schicksal der Bibliothekare und auf ihr Ansehen im k.k.Beamtenstaat eingegangen.
Bibliothekare (und Archivare) wurden sozial und bürokratieintern als bessere Magazineure, „eine Art Küster“, als Verwahrer dessen, was nach dem Skartieren übrig blieb („alte Registratur“), als skurille, graue Mäuse angesehen, die das Tageslicht scheuen und in alten Scharteken bzw. Akten lesen (Spitzweg-Image). Bis zum heutigen Tage bemühen sich einige Angehörige der genannten Dienstzweige, diesem Image gerecht zu werden.
Im 19. Jahrhundert waren die Bibliotheken mit dem systemisierten Personal nur schwer in der Lage, der steigenden Informationsflut Herr zu werden. In der Bibliothek der Universität in Wien arbeiteten im Jahr 1832 ein Bibliothekar, zwei Custoden und zwei Scriptoren. Sechzig Jahre später waren zusätzlich fünf Praktikanten und 19 Volontäre zur Aufrechterhaltung des geordneten Bibliotheksbetriebes notwendig. 15 Volontäre erhielten jährlich je 300fl. „Remuneration“, weniger als die Hälfte des niedersten Beamtenbezuges! Bereits im Jahr 1873 wurden die Bibliothekare an staatlichen Bibliotheken durch Bestimmungen der ersten umfassenden Rang- und Gehaltsregelung für k. k. Beamte diskriminiert. Der Unterrichtsminister hatte im Parlament im Interesse der sozialen Distanzierung vor allem der Universitätsprofessoren den Einwand gebracht, wenn die Universitätsbeamten und Bibliothekare nach dem neuen Gesetz besoldet würden, könnten die Bibliothekare bis zu 3600fl. jährlich erhalten, während ein Professor der Wiener Universität maximal 3200 fl. Gehalt beziehe. Dieser Argumentation schloß sich die Majorität des Abgeordnetenhauses schließlich an. Der hierarchische Unterschied zwischen den Universitätsprofessoren und den Bibliothekaren blieb auch im finanziellen Bereich bestehen.
Im Jahr 1889 wurden die Bezüge der Bibliothekare an den Universitäts- und Studienbibliotheken und an den Bibliotheken der technischen Hochschulen erhöht. Der höchste erreichbare Bezug (Bibliothekar an der Universitätsbibliothek Wien) betrug nun 2600 fl.; ein ranggleicher Beamter (VI. Rangklasse) eines anderen Verwaltungszweiges erhielt zwischen 2800 und 3600 fl. Bei den Custoden, Scriptoren und Amanuensen war die Benachteiligung in der Relation noch größer: Ein Amanuensis, der in der neunten Rangklasse war, erhielt um 500 fl. weniger als ein gleichfalls in der neunten Rangklasse stehender Gymnasialprofessor. „Das ist doch keine Lösung der Existenzfrage für Männer zwischen 30-40 Jahren“, schrieb die Beamtenzeitung und forderte, daß Anwärter für den Bibliotheksdienst ein mit Doktorgrad abgeschlossenes Studium nachweisen müßten; dann allerdings müßten die Gehälter entscheidend aufgestockt werden. Bloße Einreihung in höhere Rangklassen genüge nicht, denn:„Geld ist in gewissem Sinn auch Ehre, jedenfalls ist es Mittel zur äußeren Ehre... Rangclasse und Gehalt gehören untrennbar zusammen und postuliren einander“.
Auch die Titel der Bibliothekare wurden als obsolet betrachtet. „Amanuensis und Scriptor... wird kaum jemand gebrauchen, der das Recht hat, mit einem academischen Titel angeredet zu werden.“
Erst im Jahr 1896 wurden die Bibliothekare der staatlichen Bibliotheken auch gehaltsmäßig dem allgemeinen Besoldungsschema eingegliedert.
Ganz läßt sich der Eindruck nicht abstreifen, dass sich die Position der BibliothekarInnen - sowohl wiss. als auch öff. - nicht wirklich gebessert zu haben scheint.
Weder was die Bezahlung betrifft, noch hinsichtlich der Anerkennung durch Dienstgeber und mediale Öffentlichkeit kann einem so richtig warm ums Herz werden.
Dass auch der Verfasser dieser Studie ein in dieser Allgemeinheit sicherlich unzutreffendes Vorurteil weiter pflegt, läßt sich aus dem von mir angefetteten Satz durchaus vermuten.
Vor die Wahl gestellt zwischen Geld oder Titel würden wir heutigen BibliothekarInnen sicher auch gerne zum schnöden Mammon greifen. Doch diese Wahl wurde uns auch durch die Gemeinde Wien nicht angeboten. Stattdessen eliminierte sie quasi ohne Lohnausgleich für die B-Bediensteten alle Titel unterm Amtsrat, was so schöne Anreden wie "Büchereiverwaltungsoberkommissär" heute nicht mehr zulässt.
Die C-Bediensteten dagegen dürfen den vergleichbaren Titel (ohne "verwaltungs") aber weiter führen, da diese Position für die B-Bediensteten ein Posten in der Regellaufbahn ist, für die C-Bediensteten dagegen ein Aufstiegsposten - der letzte :-)
Aber auch die C-Bediensteten, die, auch das sei hier erwähnt, in den Wiener Büchereien die selbe Arbeit wie die B-Bediensteten machen, wurden nicht gefragt, ob sie Titel gegen "Gerstl" tauschen wollten. Was wohl ihre Antwort gewesen wäre?
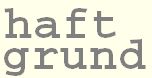
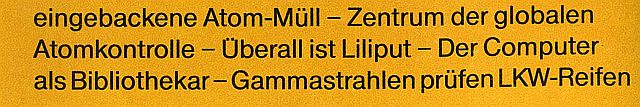
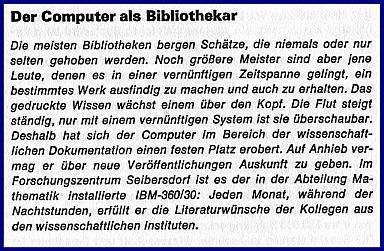
 Was natürlich sowohl hinsichtlich der Einarbeitung als auch bei der Ausleihe mehr Aufwand bedeutet; außerdem erhöhte Materialkosten durch die zusätzliche Hülle. Daher stand die Belegschaft der Bücherei vor der Entscheidung, ob nach der Transponderisierung des Medienbestands dieser zusätzliche Aufwand noch zu verantworten sei; denn die Einführung der RFID-Verbuchung ging zwar nicht mit einer Personalkürzung einher, doch durch die Erweiterung der Öffnungszeiten erfolgte naturgemäß eine Verknappung der Verwaltungsarbeitszeit.
Was natürlich sowohl hinsichtlich der Einarbeitung als auch bei der Ausleihe mehr Aufwand bedeutet; außerdem erhöhte Materialkosten durch die zusätzliche Hülle. Daher stand die Belegschaft der Bücherei vor der Entscheidung, ob nach der Transponderisierung des Medienbestands dieser zusätzliche Aufwand noch zu verantworten sei; denn die Einführung der RFID-Verbuchung ging zwar nicht mit einer Personalkürzung einher, doch durch die Erweiterung der Öffnungszeiten erfolgte naturgemäß eine Verknappung der Verwaltungsarbeitszeit. 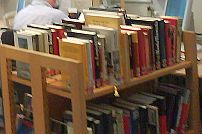

 als er mit zwar verbuchten, aber durch das heimtückische Selbstverbuchungsgerät nicht entsicherten Medien durchschreiten wollte, sodass sich alle Augen dem armen Herrn Hegel zuwandten und ein Bibliothekar ihn herrisch zu sich winkte?), will ich an die Sache theoretisch herangehen und greife berufskrankheitsbedingt zu einem Buche:
als er mit zwar verbuchten, aber durch das heimtückische Selbstverbuchungsgerät nicht entsicherten Medien durchschreiten wollte, sodass sich alle Augen dem armen Herrn Hegel zuwandten und ein Bibliothekar ihn herrisch zu sich winkte?), will ich an die Sache theoretisch herangehen und greife berufskrankheitsbedingt zu einem Buche: 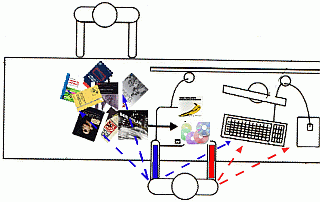

 oder
oder  oder
oder 

 Die, wie auch
Die, wie auch  Allerdings bot das "Ausweichlokal" vom Ambiente her einen viel angemesseneren Rahmen als es der doch recht sterile Veranstaltungssaal in der Hauptbücherei sein hätte können. Und ob eine derart gute Stimmung wie in der Sandleitenbücherei auch dort aufgekommen wäre, läßt sich bezweifeln.
Allerdings bot das "Ausweichlokal" vom Ambiente her einen viel angemesseneren Rahmen als es der doch recht sterile Veranstaltungssaal in der Hauptbücherei sein hätte können. Und ob eine derart gute Stimmung wie in der Sandleitenbücherei auch dort aufgekommen wäre, läßt sich bezweifeln.