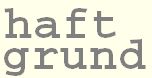Vor ca. 1 Jahr verteilte die Familienministerien Kdolsky Kondome an die SchülerInnen eines Wiener Gymnasiums.
Bilder von dieser Aktion erschienen in zahlreichen Medien und die Eltern der Kinder kritisierten zu Recht, dass sie nicht um die Einwilligung zur Veröffentlichung der Bilder ihrer Kinder gefragt worden waren.
Tatsächlich haben das Ministerbüro oder der Stadtschulrat oder der Schuldirektor gegen den im § 78 des Urheberrechts verankerten Bildnisschutz verstoßen, in dem steht:
§ 78. (1) Bildnisse von Personen dürfen weder öffentlich ausgestellt noch auf eine andere Art, wodurch sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, verbreitet werden, wenn dadurch berechtigte Interessen des Abgebildeten […] verletzt würden.
Kurz nach dieser Aktion wurden die Bediensteten der Büchereien von der MA 13 schriftlich daran erinnert, dass im Falle von Bild- oder Tonaufnahmen in den Räumen der Büchereien, z.B. bei Büchereiveranstaltungen, für den Fall einer geplanten Veröffentlichung die Einwilligung der Abgebildeten eingeholt werden müsste.
Da dies bei größeren Veranstaltungen von den Bediensteten kaum zu leisten ist, wurde von der Dienststellenleitung die Notwendigkeit erkannt, einen entsprechenden Passus in die Benutzungsordnung einzufügen, welcher den Verzicht auf den Bildnisschutz bei Büchereiveranstaltungen pauschal regelt.
Andere Institutionen mit Veranstaltungsprogramm wie die Wiener Stadthalle, die Fernwärme Wien, das Wien-Ticket-Portal, der Allevent, und die starlight-concerts verwenden fast wortident folgende Formulierung in ihren AGB:
Bei TV-Übertragungen erteilt der Inhaber dieser Karte der übertragenden TV-Anstalt seine ausdrückliche Zustimmung, daß jegliche Aufnahmen entschädigungslos ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung erstellt und mittels jedes derzeitigen und künftigen technischen Verfahrens ausgewertet werden dürfen.
Auch den Jazzclub Birdland und den Operettensommer eint bei sonstigen Unterschieden in der Stilrichtung und im Besuchergut diese Bestimmung, welche Fotoreportagen und Filmaufnahmen solcher Veranstaltungen überhaupt erst möglich machen.
Die Ermächtigungsbestimmung in den AGB dieser Institutionen wurden für die neue Benutzungsordnung der Büchereien, die nun ebenfalls "Allgemeine Geschäftsbedingungen" heißt, im wesentlichen abgekupfert.
Und damit wäre das Problem gelöst gewesen und dieser Blogeintrag nie geschrieben worden.
Da aber Bürokratien nie genug kriegen, wurde noch was draufgesetzt:
In den AGB der Büchereien, die seit Anfang 2008 gültig sind, wird der Verzicht auf den Bildnisschutz nicht auf Veranstaltungen beschränkt, sondern prinzipiell mit der Einschreibung in einer Bücherei abverlangt :
Die Büchereien Wien weisen darauf hin, dass in den Büchereiräumlichkeiten Ton-, Film- und Fotoaufnahmen gemacht werden können, die zur Veröffentlichung bestimmt sind.
Der Inhaber / die Inhaberin der Büchereikarte erklärt sich damit einverstanden, dass die von ihm / ihr während oder im Zusammenhang mit dem Büchereibesuch gemachten Aufnahmen entschädigungslos ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung mittels jedes derzeitigen oder zukünftigen technischen Verfahrens ausgewertet werden dürfen.
Die Verknüpfung mit der Einschreibung (und für die bereits eingeschriebenen Büchereibenutzer sogar retrospektiv) kommt einem Nötigungsversuch nahe, wenn man davon ausgeht, dass die Büchereien eine Einrichtung sind, die prinzipiell allen offen stehen und nicht nur jenen, die auf ein wesentliches Persönlichkeitsrecht verzichten.
Doch es kommt noch dicker: in der ebenfalls seit Jahresanfang in jeder Bücherei ausgehängten Hausordnung reicht bereits der bloße Aufenthalt in der Bücherei, dass Fotoaufnahmen von einem gemacht werden können, die dann ohne Einspruchsmöglichkeit der Abgebildeten zu allen möglichen Zwecken weiter verwendet werden dürfen.
Wenn sich die Ministerin Kdolsky also wieder zu einer Kondomverteilungsaktion entschließen sollte, wären die Büchereien der richtige Ort dafür: Eltenproteste gegen Veröffentlichungen von Fotos ihrer Kinder wären ausgeschlossen, weil die Eltern und auch sonst alle BenutzerInnen in den Büchereien da nichts mitzureden haben.
Demnächst zu diesem Thema: über vergebliche Anregungen, eindeutige Antworten und einen resignativen Ausklang.
Eigentlich sind es zwei Themen, doch wie es der Teufel will, vereinen sie sich in diesen Tagen zu einem gemeinsamen.
1)
Noch Anfang der 70er mussten jene Menschen, welche die Schwellenstarre vor Wiener Städtischen Büchereien zu überwinden vermochten, zum Zwecke der Einschreibung nicht nur einen Lichtbildausweis und einen Meldezettel vorlegen, sondern auch ihren Beruf - bei Frauen den Beruf des Mannes - angeben. Mitte der 70er setzte sich bei den BibliothekarInnen die Auffassung durch, dass sie eigentlich der Beruf ihrer Leser nichts anging und der Beruf der Ehemänner ihrer Leserinnen schon gar nichts. Das Einschreibformular wurde entsprechend vereinfacht. Auf den Lichtbildausweis wurde zumeist verzichtet, da der Meldezettel ohnehin alle benötigten Angaben enthielt und nicht anzunehmen war, dass jemand sich zum Zwecke der Erschleichung einer Mitgliedschaft bei den Städtischen Büchereien einen fremden Meldezettel aneignete.
Natürlich gab es Büchereien, in welchen die Vorschriften buchstabengetreu umgesetzt wurden, was manch hoffnungsvoller Hinauflese-Laufbahn schon vor ihrem Beginn ein jähes Ende setzte, weil es - auch angesichts der sparsamen Öffnungszeiten - nicht immer zu einem zweiten Büchereieinschreibeversuch reichte.
Aber im Großen und Ganzen wurden die Einschreibungen lockerer gehandhabt, und die potentiellen LeserInnen zumeist als so vertrauenswürdig angesehen, dass man sie auch ohne vollständige Unterlagen in die überschaubare Gemeinschaft der eingeschriebenen BüchereibenutzerInnen aufnahm.
Mit der Änderung des Meldegesetzes 2002 wurde der Meldezettel hinfällig und es musste die Entscheidung getroffen werden, ob ein Lichtbildausweis, mit dem man innerhalb Europas über alle Grenzen gelassen wird, auch für eine Mitgliedschaft bei den Büchereien Wien ausreicht.
Wie zu erwarten, wurde weiter auf die behördliche Kontrolle der Adressangaben bestanden.
Das hieß, bei jeder Einschreibung eine Abfrage des Zentralmelderegisters via Internet zu tätigen.
Alle Abfragen werden vom System protokolliert und jährlich erfolgt eine stichprobenweise Überprüfung, ob ein Missbrauch betrieben wurde.
Der Datenschutzbeauftragte der Abteilung muss dann die Abfragen auf Stimmigkeit überprüfen und die Bediensteten müssen allenfalls erklären, zu welchem Zweck sie eine Monate zurückliegende Abfrage gemacht haben, wenn z.B. die Nummer der Lesekarte nicht genau übereinstimmt.
Damit sind die Büchereibediensteten unversehens von Kontrollierern zu Kontrollierten geworden.
2)
Wie bereits berichtet, zählen die Datenleitungen der Büchereien nicht zu den schnellsten, und Anfang des 21. Jahrhunderts waren sie noch langsamer als jetzt, der ZMR-Server ist ebenfalls keine Blitzkneisser, also dauerte es zumeist eine geraume Zeit, bis die Bestätigung erfolgen konnte, dass die angegebene Adresse mit der im ZMR identisch ist.
Ein weiteres Hindernis auf dem Weg zur Nutzung der Angebote der Büchereien ist die mangelnde Datenqualität im Register. Es kamen immer wieder Fälle vor, dass künftige LeserInnen mehrfach beteuerten, dass ihre Angaben richtig seien und die im ZMR fehlerhaft.
Je nach der inneren Größe und der Bereitschaft der BibliothekarInnen, die Vorschriften allenfalls als Diskussionsvorschlag aufzufassen, wurden auch solche mit Datenmakel behaftete Menschen eingeschrieben. Oder eben nicht.
Diese Prozedur konnte in all ihren Facetten in den Wochen und Monaten nach der Eröffnung der Hauptbücherei 2003 beobachtet werden, als eine unverhofft hohe Zahl von WienerInnen Mitglieder der Büchereien Wien werden wollten.
Die dadurch entstehenden langen Schlangen wurden beileibe nicht kürzer durch die vorgeschriebenen ZMR-Abfragen.
Dabei gab es unterschiedliche Herangehensweisen durch die Bediensteten:
- Die Bibliokraten machten jede Einschreibung zu einem hochnotpeinlichen Verhör, das nur jene erfolgreich überstanden, deren Angaben mit denen des Zentralmelderegisters i-tüpfelchenmäßig übereinstimmten.
- Die gemäßigten Legalisten lavierten sich durch und entschieden nach Gefühl und Sympathie. Wie immer. Manche wurden wieder weggeschickt, die meisten aber eingeschrieben, oft mit einem Vermerk - "... wird nachgebracht"
- Und die Biblioanarchas verzichteten von vornherein auf die Abfrage, da sie der Meinung waren, dass nicht von vornherein Betrug durch die sich Anmeldenden anzunehmen sei.
Jede dieser biblioideologischen Tendenzen umfasste ca. 1 Drittel der in der Einschreibung Tätigen. Wodurch es auch zu unterschiedlichen Einschreibgeschwindigkeiten kam und geübte Schlangensteher bald herausfanden, wo es sich lohnte, sich anzustellen.
3)
Einige Zeit nach den Einschreibanstürmen der Hauptbücherei kam die zentrale Mitteilung, dass es ab nun nicht mehr notwendig sei, bei jeder Einschreibung das ZMR abzufragen, sondern nur in Zweifelsfällen und bei unzustellbaren Mahnfällen.
Man könnte sagen, das anarchistische Modell hat sich auch hier als das praxisnächste erwiesen, leider wurde es im Fall der Hauptbücherei reichlich spät gewählt. Eine alte Erfahrung.
In einer ORF-Sendung über 1968 bezeichnete der stockreaktionäre Gerd Bacher das Rudelbumsen als die einzige "Innovation" der Achtundsechziger.
Gestern packten wir den neuen Staubsauger aus.

Rechtzeitig zum fünfjährigen Hauptbücherei-Wien-Jubiläum ein frei erfundenes "Mailolett" aus den Innereien eines Büchereiensystems:
Personal, aufschreiend:- Nach dem gestrigen Wahnsinn von 15 bis 16:45 Uhr mit 3 Schaltern, möchte ich schon gern mal mein Unwohlsein mit dem fast permanenten Ausnahmezustand an den Ausleih- und Rückgabeschaltern kundtun! Die Personalknappheit beschränkt sich seit Langem nicht mehr auf irgendwelche Extremsituationen.
Es kann doch nicht sein, dass der "Normalbetrieb" nur durch Freiwillige, die auf die täglichen Hilferufe reagieren und einspringen, aufrecht erhalten werden kann!
Deshalb verstehe ich es nur zu gut, dass uns gestern niemand unter die Arme gegriffen hat.
Als kurzfristige Sofortmaßnahme könnte zumindest der Vorschlag der vor ca. 2 (?) jahren tagenden Thekenarbeitsgruppe umgesetzt werden, dass für den 4. Schalter eine Art Bereitschaftsdienst eingerichtet wird (ein/e KollegIn auf Abruf im Büro).
Aber grundsätzlich bin ich der festen Überzeugung, dass wir mehr Personal brauchen!
Wie wär es z.B. mit Personal statt den Kassenautomaten, die eh' nur streiken?
Es spricht nicht für unser Service, wenn wir die LeserInnen solchen Situationen wie gestern aussetzen.
Leiter, beschwichtigend:- Wir werden in Hinkunft mit der Besetzung der Mischarbeitsplätze großzügiger umgehen im Nahfeld von Feiertagen bzw. Ferien.
Dabei wird zu überlegen sein, inwieweit nicht statt der zweiten Einschreibung der Mischarbeitsplatz öfter fix besetzt werden soll.
Ich denke, dass die Einschreibezahlen in den meisten Fällen so sind, dass das vertretbar ist.
Es macht auch für die NutzerInnen keinen so tollen Eindruck, wenn, was manchmal vorkommt, sich zwei KollegInnen bei der Einschreibung fadisieren und vor 3 Buchungsschirmen die Schlangen stehen.
Mit den Kassenautomaten bohren Sie natürlich in einer offenen Wunde von mir - da hoffe ich sehr, dass die neue Anbindung an die Telekom bald positiv zum Tragen kommt - einfach gesagt: dass die Dinger endlich funktionieren dürfen (es liegt ja nicht an den Automaten, sondern an der Datenleitung).
Zur Personalfrage: ich glaube, wir werden mit dem vorhandenen Personal auskommen müssen , aber ich stimme Ihnen zu, dass es den Kundinnen nicht zumutbar ist, so lange Wartezeiten in Kauf nehmen zu müssen.
In Zeiten mit erwarteteter großer Frequenz wird daher in Zukunft die Verbuchung jedenfalls noch mehr Vorrang haben vor der Back-Office-Tätigkeit.
Personal, resignierend:
- Also gestern haben sich definitiv nicht 2 Leute bei der Einschreibung "fadisiert", im Gegenteil von 17- nach 18 h war dort eine Schlange, Ausserdem ist dann dort eh nur 1 Platz besetzt.
Zu der Besetzung nach Einschreibezahlen möchte ich nur bemerken, dass sich die LeserInnen halt nicht an Statistiken halten und üblicherweise manchmal gar nicht, dann aber perfiderweise wieder gleichzeitig eingeschrieben werden wollen.
Allen, auch dem Leiter, ist klar: es ist zu wenig Personal da. Die Aufsplitterung der Schnittstellen zwischen Bücherei und BenutzerInnen durch Funktionsfiletierung an den Theken, der Einsatz von Verbuchungsmaschinerie sowie das Hinzuschaufeln von Hilfskräften mit prekären Arbeitsverhältnissen, brachte letztendlich keine Entlastung für die BibliothekarInnen.
Immer weniger Zeit bleibt für die bibliothekarische Basisarbeit "hinter den Kulissen".
Durch die vor einigen Jahren erfolgte Zerschlagung des Lektorats und die Übertragung von dessen Funktionen an die einzelnen Colleges sind von dieser Reduzierung auch die Zweigstellen betroffen, die schon lange den Eindruck haben, dass die Medienauswahl für sie bloß als Nebenprodukt des Eigenankaufs der Hauptbücherei fungiert. Bei den über die quantitative Zuteilung hinausgehenden unterschiedlichen qualitativen Bedürfnissen am Bestandsaufbau zwischen Hauptbücherei und Zweigstellen und zwischen Stützpunktbüchereien und Zweigstellen nimmt es nicht wunder, dass die Kritik an der Unzulänglichkeit der Auswahllisten für die Zweigstellen immer lauter wird.
Es ist ein Teufelskreis. Den politisch Verantwortlichen und dem Magistrat ist nichts zu teuer, um Personal einzusparen und den Schein eines funktionierenden Systems aufrechtzuerhalten.
Die politikkompatiblen Erfolgsmeldungen müssen immer lauter werden bei rahmenbedingt leise sinkender Qualität.
Und die Frustrationen der Belegschaft werden erfahrungsgemäß eines Tages in innere Kündigungen umschlagen.
Dann kann man ja immer noch den Betrieb aus dem Magistrat auslagern und ihn hauptsächlich über angelernte und "ehrenamtliche" Kräfte aufrecht erhalten ...
zu dem Satz
Wie wär es z.B. mit Personal statt den Kassenautomaten, die eh' nur streiken?
wäre vielleicht noch zu sagen, dass gerade das Streiken nicht den Maschinen überlassen werden sollte ...
Als Teil der Selbstabfeierung von fünf Jahre Hauptbücherei Wien findet dieses Podiumsgespräch unter einem ausgesucht schwammigen Titel statt [außer es sollte wirklich "virtuell" statt "virtueller" heißen. Das hätte eine gewisse sprachliche und inhaltliche Spannung]. Auch der Begleittext wirkt nicht gerade aufbruchsstimmig oder vermittelte gar bibliothekspolitische Brisanz. Dass Bibliotheken auf gesellschaftliche Entwicklungen zu reagieren hätten, dürfte seit geraumer Zeit nicht ganz unbekannt sein. Dass es politisch zu verantwortende Rahmenbedingungen gibt, die dies verhindern, auch nicht.
Es ist nicht zu erwarten, dass die einzige Vertreterin "der Politik", die Gemeinderätin Barbara Novak irgendwas Substantielles beizutragen imstande sein wird: obwohl sie Vorsitzende des sogenannten "Vereins der Freunde [gibt es keine Frauen dabei?] der Büchereien Wien" ist, sind keinerlei Stellungnahmen von ihr bekannt, die irgendeine bibliothekspolitische Perspektive auch nur erahnen lassen.
Für die Vertreter der Stadt-Wien-dominanten SPÖ scheint sich mit dem Bau der Hauptbücherei und der Philadelphiabrückenbücherei die bibliotheksperspektivische Zukunft wohl ein für alle mal erfüllt zu haben.
Bin gespannt ob sich aus den Diskussionsbeiträgen genügend Material für ein volles bibliotheksspezifisches Bullshit-Bingo ergibt.
Falls nicht, wäre ich angenehm enttäuscht.
Mittwoch, 09.04.2008,
10.00 bis 12.00 Uhr
3. Wiener Büchereigespräch
„Virtuell und Öffentlicher Raum – die öffentliche Bücherei der Zukunft“
Neue Wege der Distribution von Wissen, Musik, Filmen, Hörbüchern stellen auch neue Anforderungen an Bibliotheken. Mit Bibliotheksportalen können Bibliotheken ihren KundInnen Angebote unabhängig von den Bibliotheksräumen und den Öffnungszeiten zur Verfügung stellen. Gleichzeitig ist die Bibliothek gefordert, auf gesellschaftliche Entwicklungen wie Zuwanderung/Integration, Aging Society und lebenslanges Lernen mit attraktiven Räumen und Angeboten zu reagieren.
BibliotheksexpertInnen und Politik erörtern Perspektiven für moderne Bibliothekssysteme der Zukunft.
Podium:
- Barbara Novak - Abgeordnete zum Wr. Landtag, Vorsitzende des Vereins der Freunde der Büchereien Wien
- Nikolaus Gradl - Stadtrat München, stv.Verwaltungsbeirat Bibliotheken
- Markus Feigl - Bibliothekarischer Leiter der Büchereien Wien
- Ingrid Bussmann - Direktorin der Stadtbücherei Stuttgart
- Hella Schwemer-Martienßen - Direktorin der Bücherhallen Hamburg
- Juraj Šebesta - Direktor der Städtischen Bibliothek Bratislava
Moderation: Christian Jahl – Leiter der Hauptbücherei Wien
Für diese Veranstaltung ist eine Anmeldung bis zum 4.April 2008 unbedingt erforderlich!
Anmeldung per Mail an : post@buechereien.wien.at
telefonische Anmeldung : + 43 1 4000 84510 + 43 1 4000 84509
Beim Entsorgen der Gratis-Wochenendzeitungen gefunden. Kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass der Exsoldat im Grunde seines Herzens nicht ganz einsieht, dass er mit seinen Untergebenen in der Firma anders umgehen sollte, als seinerzeit mit jenen in der Kompanie.
Denn immerhin scheint es doch bei seinen selbst gezeugten Rekruten gewirkt zu haben. Und wetten, dass auch der Hund pariert?
Vom Offizier zum Bankengeneral
Die Wortwahl des ranghohen Offiziers lässt mitunter auf seine militärische Vergangenheit schließen. Etwa, wenn er – auf seine Visionen angesprochen – davon spricht, dass er „Wien erobern möchte“. Den militärischen Ton hat er hingegen fast gänzlich abgelegt. Befreundete Arbeitskollegen hätten ihm nahegelegt, dass man beim Telefonieren „dasselbe auch anders sagen kann.“
„Die Sprache ist im Militär anders, das Resultat verändert sich aber nicht, ob man nun eine Bitte oder einen Befehl ausspricht.“
„Wichtig ist nur, dass alles nachvollziehbar bleibt. Auch im Militär ist das Verständnis für den Befehl wichtig. Es heißt ja: den Auftrag erfassen.“
Der Generaldirektor der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien hat mit 1. Juli 2007 auch das Oberkommando in der Raiffeisenlandesbank (RLB) NÖ-Wien übernommen.
Ob er als etwas strengerer Chef wahrgenommen wird als sein Vorgänger, der den Spaß am Arbeitsplatz [in meiner Kompanie nicht!!. Anm.] postulierte?
„Ein wesentlicher Faktor ist, dass die Mitarbeiter im Unternehmen eine zweite Heimat [wie die Kaserne wohl. Anm.] finden. Aber ich mag es nicht, wenn Dinge zu lange diskutiert werden.“
Seine Ehefrau sei übrigens ob seines Wechsels in die Wirtschaft sehr glücklich gewesen. „Der militärische Tonfall hat sie schon gestört.“ Diesbezügliche Ecken und Kanten seien ja nun abgeschliffen.
Den „wohlgeratenen“ erwachsenen Söhnen, einem Techniker und einem Betriebswirt, hätten die ehemals anderen Töne aber offenbar nicht geschadet.
("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.03.2008)
"Die Kirchengemeinde gibt sich zugeknöpft". Das kann schief gehen, wenn diese Gemeinde St. Blasius heißt. Andererseits steigt die Hoffnung auf geringeren Sünden-Traffic, wenn alles hübsch zugeknöpft ist.
Daher kann der schon dem Namen nach passende Bistumssprecher Ohnesorge die Erregung nicht nachvollziehen, die in Fulda Platz greift, weil jener Schlecker , der sich in ein Haus im Eigentum der Diözese eingemietet hat, auf Weisung des Hausherrn jenes Tool nicht mehr vertreiben darf, welches im Falle einer sicher nicht von der Kirche hervorgerufenen Erregung seine nachkommenhemmende Wirkung entfalten sollte.
Prinzipiell ist es gut, wenn der katholische Klerus den Zölibat so ernst nimmt, dass ihm Erregung fremd bleibt. Und nichts daran ist kurios, wie Ohnsorge dem HR-inline unerregt kundtut.
Da in den Zweigstellen der Wr. Büchereien nicht nur die Selbstverbucher, sondern auch die Internetschirme und die Opacs für die BenutzerInnen gelegentlich zu langen kontemplativen Minuten anregen, bis sich die gewünschten Seiten aufgebaut haben, war auch hier eine kleine Einsicht in die Innereien angebracht. Das Ergebnis ist wenig überraschend:
Die Internetschirme sind zwar etwas schneller als die Selbstverbucher -- AMD Athlon xp 3000+ mit einer CPU von 2100 MHz, ist nicht der letzte Schrei, aber ein solches Gerät mit 1024 MB Arbeitsspeicher und unter Verwendung einer ressourcenschonenden Oberfläche unter Linux läuft erfahrungsgemäß ganz gut
.
Die Büchereigeräte haben allerdings nur 187 MB Arbeitsspeicher. Von denen bleiben nach dem Start 9 MB zur freien Verfügung. Laufen tuts unter Wienux, das auf einem Debian 3.1 aufsetzt. Was ja kein Fehler wäre. Allerdings sind die Geräte so konfiguriert, dass es kein Automounten gibt, das heißt, bei jedem Überspielen auf USB-Stick oder Diskette muss gemountet werden, was theoretisch von den UserInnen selbst gemacht werden könnte, da auch eine Anleitung aufliegt, doch die wenigsten schaffen das, also müssen es die BibliothekarInnen machen. Beim nächsten Start ist der Mountpunkt natürlich wieder gelöscht. Das CD-Rom-Laufwerk ist gesperrt, somit kann weder gebrannt werden, was das vorhandene eh nicht könnte, noch können Dateien auf CD fürs Versenden per Mail oder zum Ausdrucken geholt werden.
Das Drucken. Es gibt einen einzigen Drucker, der sowohl die Ausdrucke von den internen PCs ausdruckt als auch die von den Publikumsschirmen. Die BenutzerInnen wühlen dann gegebenenfalls in internen Dokumenten bis sie die eigenen Ausdrucke finden. Umgekehrt wühlen die BibliothekarInnen in den UserInnendokumenten, die sie auch nichts angehen. Die Druckeinstellungen können von den UserInnen an den Publikumsgeräten verstellt werden. Was auch geschieht. Dann gibt es eine Menge fehlgeschlagener Druckaufträge, welche das Drucken auch dann weiter blockieren, wenn der richtige Drucker eingestellt wurde. Die Druckaufträge löschen können sie allerdings nicht, da müssen wieder die BibliothekarInnen eingreifen.
Das Geheimnis, warum Diskettenlaufwek und USB-Anschlüsse nicht automatisch beim Start gemountet werden, konnte bislang nicht gelüftet werden. Warum das CD-Rom-Laufwerk nicht aktiviert werden kann, schon. Das sei Absicht.
Dagegen wird es ein Rätsel bleiben, wieso es nicht möglich sein soll, den Zugriff auf die Druckereinstellungen für die normalen UserInnen zu sperren.
Vermutlich Zeitmangel aller EDV-Beschäftigten. Das gilt generell: immer mehr Geräte, immer mehr zusätzliche Aufgaben sowie Demotivierungskampagnen durch Fehlentscheidungen von oben.
Dass dies den Zeitaufwand in den Zweigstellen vervielfacht, ist eine andere Geschichte und nicht weiter zu beachten.
Mit der Eröffnung der neuen Hauptbücherei 2003 hat auch die RFID-Technik Einzug in das Wiener Büchereisystem gehalten. 2004 folgt die Bücherei Philadelphiabrücke als zweitgößte Bücherei . Während die Hauptbücherei das RFID-System auf die Theken- und Selbstverbucherentlehnungen beschränkt, gibt es für die BenutzerInnen in der "Phia" auch die Möglichkeit, die Rückverbuchung selbst zu machen. Beide Büchereien sind an das superschnelle Glasfaserkabelnetz des "Wiener Bildungsservers" angeschlossen. Nach erheblichen Anfangs- und Zwischenproblemen funktioniert das Selbstverbuchungssystem mit der RFID-Technik halbwegs zufriedenstellend. Mit Einschränkungen, aber davon vielleicht ein andermal.
Seit September 2007 sind nun drei weitere, für Wiener Verhältnisse große Zweigstellen (ca. 40.000 Medien, 200.000 Jahresentlehnungen) mit RFID-Chips und Selbstverbuchungsgeräten ausgestattet worden.
Diese Büchereien laufen über das viel langsamere normale Magistratsnetz und auch die Bandbreite wird aus Kostengründen nicht optimiert. Kein Wunder, dass die Verbuchung ziemlich zögerlich vor sich geht. Bei den Ausleihe- und Rückgabetheken funktioniert es halbwegs, wenn auch langsamer als die vorher verwendete Methode mit Barcode und Lesegerät, gelegentlich werden die wartenden BüchereibenutzeInnen unruhig, wenn die Bibliothekarin schweigend für längere Zeit in den Bildschirm starrt. Es entsteht der Eindruck, dass irgendwas nicht in Ordnung sei, doch ist es nur das Warten auf den gemächlichen Bildschirmaufbau bei der Verbuchung.
Ärgerlicher ist das Ganze bei den Selbstverbuchungsgeräten. Monatelang bedurfte es einer überdurchschnittlichen Fingerfertigkeit, die Leserkarten zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Winkel so in den Lesestrahl zu halten, dass sie auch eingelesen werden konnten. War das nicht der Fall, dann erschien nach einem kurzen Timeout wieder der Anfangsbildschirm. War diese Hürde überprungen, funktionierte in der Regel die Verbuchung von Büchern langsam aber doch. Die von CDs gelegentlich, von Medienpaketen zumeist gar nicht. Was nicht nur bei den BenutzerInnen zu ausgeprägten Frusterlebnissen führte, sondern auch bei den BibliothekarInnen, welche natürlich danach trachteten, den BenutzerInnen die Scheu vor dem Gerät zu nehmen und ihnen zu vermitteln, dass es eh ganz einfach sei. Wenn sie es dann vorführten, und unter den Augen der LeserInnen ebenfalls scheiterten, erlitt die Motivationskurve gelegentlich einen Knick und das Selbstbewusstsein einen Knacks.
Nach einigen Monaten ließ sich die Sache mit dem Einlesen der Karten beheben, es war einfach ein Konfigurationsfehler im Programm gewesen.
Die Geschwindigkeit ist weiterhin quälend langsam und die Geräte sind alles andere als eine Attraktions fürs Publikum. Die ursprünglich von drei auf zwei Theken reduzierten "Menschenportale" mussten nach zum Teil massiven Protesten der LeserInnen wieder auf drei erhöht werden.
Da es mit der Einführung der Selbstverbuchung auch eine Erweiterung der Öffnungszeiten gegeben hatte, verbringen die Bediensteten entgegen den vollmundigen Versprechungen der Leitung mehr Zeit als zuvor an den Ausleihetheken. Denn auch nach Monaten werden die Selbstverbucher durch die vielen Frusterlebnisse nur von einem Bruchteil der LeserInnen benutzt.
Ein Blick in die Hardware der Selbstverbuchungsgeräte zeigte nun, dass der Magistrat zwar unendlich viel Geld auszugeben bereit ist, damit der nominelle Personalstand eingefroren bleibt oder vermindert wird, aber dort wo die Schnittstelle BürgerInnen/Dienstleistung ist, sich nur zu symbolischen Aktionen bereit findet und das Angebot damit real verschlechtert:
Im Gehäuse der 2007 angeschafften Selbstverbucher stecken 600Mhz-Celeron-Prozessoren (Baujahr 2000) mit 491 MB Arbeitsspeicher!
Nach dem Start des auf Oracle basierenden Bibliothekssystems gibt es noch 89 MB freien Speicher. Noch vor jeder Verbuchungsaktion!
Das heißt, die Wirkung des vielen Steuerzahler-Geldes, welches in das neue System hinein gesteckt worden ist, verpufft weitgehend, weil genau an der Schnittstelle zu den BürgerInnen auf geradezu dumme und fahrlässige Weise an der Hardware gespart wurde.
Das Ergebnis sind unzufriedenere BüchereibenutzerInnen, denn durch die Verlängerung der Öffnungszeit verdünnt sich auch der Personalstand, was eine Verringerung der Beratungsmöglichkeit nach sich zog, und gestresste Bedienstete, die sich wieder einmal fragen müssen, ob die Professionalität, die ihnen abverlangt wird, ab einer gewissen Hierarchiestufe zu den überflüssigen Eigenschaften zu gehören scheint.
Die MA 13 plant übrigens, weitere, kleinere, Zweigstellen mit RFID zu versehen.
Anläßlich ihres 80. Geburtstages wird die viele Jahre an der Wiener Staatsoper tätig gewesene Opern- und Konzertsängerin Christa Ludwig in einem Interview in der Presse abschließend gefragt, ob die Musik in ihrem Leben nach der Bühnenkarriere eine große Rolle gespielt habe.
"Eigentlich wird die Stille für mich immer wichtiger. Aber wenn eine Achte Bruckner auf dem Programm steht, dann schalte ich das Radio sicher ein ..."
Während auf den vorderen Seiten der christlich-abendländischen Untergangszeitung "Krone" der intelligent designte Kardinal Schönborn allwöchentlich seinen sakralen Ausfluss absondern darf, kann die Leserschaft weiter hinten im wöchentlichen "Psychotest" herausfinden, wie es ist um ihre Seelenlandschaft bestellt ist. Diesmal wird sie auf ihre Glaubensfestigkeit hin abgeklopft. Mit einem niederschmetternden Ergebnis: 42 % sind Atheisten - die werden in der Testauswertung pädagogisch darauf hingewiesen, dass sie nicht auf die Gläubigen runterschauen sollen, solange sie nichts besseres anzubieten hätten. 18 % sind strikt abergläubisch und hätten daher ungelöste psychische Probleme, wie ihnen beschieden wird. Und der schnöde Rest von 40 % ist so sicher in seinem Glauben, dass er erst gar nicht auf die Idee kömmt, andere bekehren zu müssen, wie die Testmacher zu wissen glauben.
Naturgemäß drängt sich die Frage auf, ob die Zahl des atheistischen Element in der Kronenzeitungslesergemeinde seit der Kolumne des ebenfalls aus uraltem aAdel stammenden Kardinals gestiegen oder gefallen ist?
Als regelmäßiger Leser dieser wöchentlichen Zwergpredigt vermute ich, dass sie aufgrund ihrer inhaltlichen Aufbereitung und der Logik ihrer Argumentationsketten tatsächlich hilfreich für Menschen mit Glaubenszweifeln sein kann.
Und es offenbar auch ist, wie man an den 42 % sieht.
Bekanntlich sind im April 1919 Adelstitel und die Privilegien des Adels in Österreich gesetzlich abgeschafft worden und der Gebrauch von Prädikaten und Titeln wurde unter Strafe gestellt (Adelsaufhebungsgesetz StGBl. Nr. 211, Vollzugsanweisung am 18. April 1919, StGBl. 237):
§ 2.
Durch § 1 des Gesetzes vom 3. April 1919, St. G. Bl. Nr. 211, sind aufgehoben:
1. das Recht zur Führung des Adelszeichens "von";
2. das Recht zur Führung von Prädikaten, zu welchen neben den zugestandenen die Familien unterscheidenden Adelsprädikaten im engeren Sinne auch das Ehrenwort Edler sowie die Prädikate Erlaucht, Durchlaucht und Hoheit gezählt wurden;
3. das Recht zur Führung hergebrachter Wappennamen und adeliger Beinamen;
4. das Recht zur Führung der adeligen Standesbezeichnungen, wie z. B. Ritter, Freiherr, Graf und Fürst, dann des Würdetitels Herzog, sowie anderer einschlägiger in- und ausländischer Standesbezeichnungen;
Im Jahr 2008 ist in der Kleinen Zeitung am 13. März eine Todesanzeige zu lesen:
Hans Stubenberg gibt im eigenen sowie im Namen
- seiner Gemahlin Maria Andrea Herrin und Gräfin von und zu Stubenberg, geborenen Reichsfreiin von Sternbach,
- seiner Söhne Maximilian und Paul, Herren und Grafen von und zu Stubenberg,
- seiner Tante Leopoldine Gräfin Dorbrzensky von Dobrzenicz, geborenen Prinzessin von Lobkowicz
dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat (...)
- Anna Maria Herrin und Gräfin von und zu Stubenberg, geborene Gräfin Dobrzensky von Dobrzenicz
(...)findet am Samstag, dem 15. März 2008 (...)
In den Durchführungsbestimmungen des Adelsaufhebungsgesetz heißt es weiter:
"1) Die Führung von Adelsbezeichnungen (§ 2), sowie von aufgehobenen Titeln und Würden (§ 3) wird von den politischen Behörden gemäß § 2 des Gesetzes vom 3. April 1919, St. G. Bl. Nr. 211, mit Geld bis zu 4000 S oder Arrest bis zu sechs Monaten bestraft.
(2) Strafbar ist hienach nicht nur die Führung solcher Bezeichnungen im öffentlichen Verkehr, das heißt im Verkehr mit Behörden und öffentlichen Stellen sowie in an die Öffentlichkeit gerichteten Mitteilungen und Äußerungen, sondern auch die Führung im rein gesellschaftlichen Verkehr und der Gebrauch von Kennzeichen, die einen Hinweis auf den früheren Adel oder auf aufgehobene Titel oder Würden enthalten, soferne darin eine dauernde oder herausfordernde Mißachtung der Bestimmungen des Gesetzes zu erblicken ist."
Umgangen wird in diesem Fall dieses Gesetz dadurch, dass der Verfasser der Todesanzeige (Hans Stubenberg) selber auf die Führung des Adelstitels verzichtet und nur andere damit "schmückt". Ei ei, wieder ein feiner Streich des ... (siehe Überschrift)
Erinnert an den Streich, den die Proponenten der "Vereinigung der Edelleute" unter der schwarzen Koalition spielen haben können: sie erreichten, dass dieser Verein durch die Vereinsbehörde anerkannt wurde und damit aus ihrer Sicht implizit auch das Führen von Adelstiteln erlaubt wäre.
An sich ist das alles ganz lustig. Dass diese Bande aber in der Summe immer noch ein Schweinegeld hat und zu den größten Grundbesitzern zählt, ist weniger erheiternd. Über die Ursprünge des Reichtums alter Adelsfamilien hat Bernd Engelmann in "Wir Untertanen" vor langer Zeit schon ein sehr aufschlussreiches (und leider vergriffenes) Buch geschrieben.
Zum Abschluss ein Ausschnitt aus dem österreichischen Sagenschatz:
Auf der nun schon lange in Trümmer zerfallenen Burg Oberkapfenberg im Mürztale hauste das Geschlecht der Herren von und zu Stubenberg, deren eigentlicher Stammsitz das noch erhaltene Schloß Stubenberg im Feistritztale gewesen. Zwei Brüder aus diesem Geschlechte führten ein echtes Raubritterleben. Da sie es gar zu toll trieben, ergrimmten die übrigen Ritter ihrer Umgebung und rückten ihnen hart an den Leib. Da zogen die beiden Stubenberger mit allen ihren erbeuteten reichen Schätzen, von wenigen Getreuen begleitet, in die damals fast unzugänglichen Waldschluchten des Schöckels und erbauten die Feste Stubegg. Von hier aus setzten sie nun ihr tolles Treiben ärger als früher fort, raubten nicht nur reisende Kaufleute aus, sondern plünderten auch manches Gotteshaus und vergriffen sich dadurch selbst an den Schätzen der Kirche. Da belegte der Papst die beiden Brüder mit dem Kirchenbanne.
[dann beschlossen sie zur Aufhebung des Banns einen Kreuzzug zu machen und dachten natürlich dabei an das Wichtige zuerst:]
Bevor sie jedoch die Heimat verließen, dachten sie an die Sicherung ihres Reichtumes ...
Zum 125. Todestag von Marx und weil es unlängst auch schon wieder 160 Jahre her ist, dass das "Kommunistische Manifest" erschienen ist, hier eine Fassung des Manifests in Hexametern, versucht von Bert Brecht im Exil.
Die Durchstreichungen sind Aktualisierungen: es gab nie Tanks und Bomber im Namen des "Kommunismus". Und, es ist mehr als fraglich, ob dieser Begriff je wieder verwendet werden kann für das, wofür er 1848 gestanden hat.
Kriege zertrümmern die Welt und im Trümmerfeld geht ein Gespenst um.
Nicht geboren im Krieg, auch im Frieden gesichtet, seit lange.
Schrecklich den Herrschenden, aber den Kindern der Vorstädte freundlich.
Lugend in ärmlicher Küche kopfschüttelnd in halbleere Speisen.
Abpassend dann die Erschöpften am Gatter der Gruben und Werften.
Freunde besuchend im Kerker, passierend dort ohne Passierschein.
Selbst in Kontoren gesehn, selbst gehört in den Hörsälen, zeitweis
Riesige Tanks besteigend und fliegend in tödlichen Bombern.
Redend in vielerlei Sprachen, in allen. Und schweigend in vielen.
Ehrengast in den Elendsquartieren und Furcht der Paläste
Ewig zu bleiben gekommen: sein Name ist Kommunismus.
2 Sanitäter in der Sanitätsuniform setzten sich bei der Station 3. Tor Zentralfriedhof neben mich in den 71er. Angesichts der an ihnen wahrnehmbaren Erschöpfungsmerkmale ist im Interesse der PatientInnen zu hoffen, dass sie sich auf dem Weg von und nicht zu der Arbeit befanden. Zwei Stationen später, auf der Höhe des 1. Tors Zentralfriedhof, begann einer zu reden: "und das ist echt arg. Da kommen plötzlich 20 Angreifer und du hast keine Chance, auch wenn deine Sicherung urgut ist...."
Bis zur Endstation der U-Bahn erzählten sie einander - sichtlich munterer geworden - über Varianten und Taktiken bei den unterschiedlichen Ego-Shooter-Spielen.
Ein geglücktes Beispiel von Work-Life-Balance?
Library Mistress berichtet über neu erlassene Blogvorschriften für britische Staatsbedienstete, denen zufolge die Civil Servants weder anonym noch kritisch über den Staatsapparat schreiben dürfen.
Anlass war ein staatskritischer Blog einer Staatsbediensteten - "Civil Serf" -, der inzwischen verstummt ist
Den Links nach zu schließen ist die Empörung darüber groß.
Zum Glück ist in Österreich alles anders. Da herrscht auch für Öffentlich Bedienstete Rede- und Meinungsfreiheit, denn in unserem Land wissen die Regierenden, dass ein Staatsapparat und die kommunale Verwaltung nur dann gut funktionieren können, wenn ihre Bediensteten selbstbewusst, kritisch und angstfrei sind. Vorreiterrolle in diesem demokratischen Musterland hat wieder einmal der Wiener Magistrat und hier wiederum sind es die Büchereibediensteten, welche besonders frank und frei ihre Vorschläge und Kritik äußern dürfen, wie aus gegebenem Anlass unlängst wieder unter Beweis gestellt worden ist!