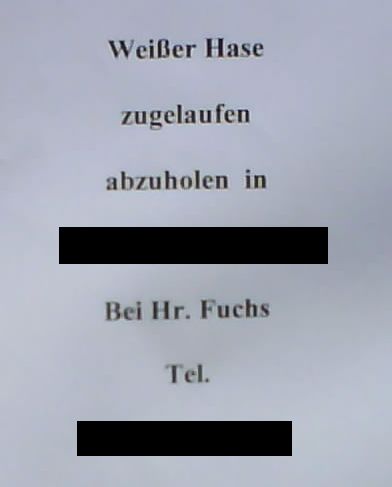Im heutigen Falter 30/08 S. 18 wird unter dem Titel "Der Elf-Minuten-Mensch. Leben 2.0." von Ingrid Brodnig anhand einer Studie von Gloria Mark festgestellt und gefragt: "Immer mehr Geräte versprechen Effizienz und bessere Kommunikation. Stattdessen lenken sie uns dauernd ab. Warum wehren wir uns nicht?"
Die Studie ist übrigens auch schon vier Jahre alt und "Die Zeit" hat aus ihr vor zwei Jahren die Befürchtung abgeleitet: "Vor lauter Unterbrechungen gibt die Menschheit bald den Geist auf."
Ähnliches befürchtet offenbar die "Falter"-Redakteurin und zitiert zum Thema noch einige andere "Unterbrechungsforscher", wie sie "Die Zeit" so hübsch nennt (oder ist dies eine Eigenbezeichnung dieser relativ neuen ForschungsnischenbewohnerInnen?), updatet die angejahrte Geschichte mit Facebooknutzungsdaten, läßt einen Soziologen davon reden, dass der durchschnittliche Amerikaner nur noch zwei statt drei enge Freunde sein eigen nennt (der tief in die Vergangenheitsform geschobene Antiamerikanist in mir flüstert völlig unangebracht: für einen Amerikaner ist das ja recht viel) und veranlasste "Falter"-KollegInnen zu eigenen, recht uninteressanten Schilderungen, wie sie mit ihrem elektronischen Werk- und Spielzeug umgehen. All dem haftet etwas Jammriges an, ähnlich wie auch dem Erlebnisbericht "Ich bin dann mal offline" des sich "Internet-Junkies" nennenden Marc Röhlig.
Der Nudelwalker hat sich zu Recht leicht sarkastisch über diese aufgesetzte Demonstration von angeblicher Charakterstärke geäußert und auf ein klassisches Beispiel eines "Furchtbar-was-macht-diese-neue-Technik-doch-mit-mir!" hingewiesen, welches wohl zu den häufigsten kindlichen Traumen der meisten später BibliothekarInnen und BücherantInnen Gewordenen zählen dürfte.
Jene, die heute über die Anmutungen der Internet- und Kommunikationsmedien jammern, waren zumeist auch diejenigen, die uns vor Jahren mit ihrem ungefragt vorgeführten neuen Spielzeug nervten. Das war schon in der Frühzeit der Handys so, wenn die wenigen Handybesitzer, die es damals gab, blitzschnell zu diesem teuren Ding griffen und sofort lospalaverten, wenn ein Bekannter in der Nähe aufkreuzte; oder mit einer Regelmäßigkeit angerufen wurde, dass damals der Verdacht die Runde unter den Spöttern machte, dass die wenigen Handybesitzer ein Netzwerk des Telefonterrors gebildet hätten, dessen einzige Aktivität darin bestand, sich ohne Unterlass gegenseitig anzurufen. Damals ging auch kaum jemand dieser Tinnitus-Aktivisten aus dem Haus, ohne das einer Revolvertasche ähnelnde "Handybag" umgeschnallt zu haben. Erst Umberto Eco hat den Bann gebrochen, als er in einer seiner Glossen darauf hinwies, dass die Handyträger nicht die wichtigen Menschen seien, weil wichtige Menschen jene wären, die sich von Untergebenen vor unerwünschten Kontaktaufnahmen abschirmen lassen:
"Wer das Handy als Machtsymbol heraushängen will, zeigt damit in Wirklichkeit doch nur allen seine verzweifelte Lage als Subalterner, der gezwungen ist, in Habachtstellung zu bleiben, auch wenn er gerade einen Beischlaf vollzieht".
Nicht gerade ein Status, welcher von den Handyträgern vermittelt werden wollte. Dazu passt ja auch, dass jemand wie Peter Westenthaler lange Zeit ausschließlich als "Haiders Handy" wahrgenommen wurde, ehe es beschlossen hatte, als Politiker laut zu werden.
Wenn man davon absieht, dass es außer wirklich Kranken jedem, der halbwegs seine Sinne beisammen hat, zuzumuten ist, seinen Umgang mit den Arbeitswerkzeugen und Spielzeugen vernünftig zu regeln, überschattet diese eitle Jammerei das wirkliche Problem: dass eine immer größere Zahl von Menschen bei der Strafe des Jobverlustes dazu gezwungen ist, stets und überall erreichbar und damit verfügbar zu sein. Dass dieses Anforderungsprofil als Randerscheinung - wie die prekären Arbeitsverhältnisse - mehr und mehr in der Mitte der Arbeitswelt zur Norm wird. Daher auch nicht mit dem einer Diätkur ähnlichen Verhaltensweise das Auslangen gefunden werden kann, sondern konkreter Widerstand notwendig ist. Darüber läßt sich aber nicht so infosexy berichten.
Weil auch mal was Positives geschrieben werden sollte: der Falter-Eigen-Hero der Woche ist diesmal Florian Klenk für seinen Artikel über die "Arigona-Spitzelaffäre"; ihm und Peter Pilz ist es zu verdanken, dass dieser Skandal noch nicht juristisch entsorgt werden konnte wie seinerzeit die FPÖ-Spitzelaffäre. Wobei die beiden sowieso als Dauer-Heroes für Namhaftmachung von Verbrechen im Politmilieu gelten können.
Brecht hätte wohl gesagt: ... arm ein Land, das Heroes braucht, um Selbstverständlichkeiten durchzusetzen. Womit wir wieder bei der feigen SPÖ wären, die seit einem halben Jahr kein Ohrwaschel gerührt hat, um gegen die Willkür der Behörden und des Innenministers im Arigona-Skandal einzuschreiten ...
Bei den zahlreichen Einbrüchen in den Wiener Büchereien im letzten Jahrzehnt wurde von den Einbrechern zwar die Kassen ausgeräumt, doch die Entleih-Medien nicht angerührt. Anders ist es mit jenen BüchereibenutzerInnen, die während der Öffnungszeiten kommen und sich ihren Anteil am gesellschaftlichen Eigentum zu sichern glauben, indem sie Teile des Büchereibestands privatisieren.
Einen Bücherschwund hat es bekanntlich immer gegeben, in kleineren, überschaubaren Büchereien weniger, in größeren mehr. Dem Einhalt geboten hat, neben dem Gewissen der BenutzerInnen und der sozialen Kontrolle, vor allem eine entsprechende Präsenz des Bibliothekspersonals sowie die Sicherung privatisierungsanfälliger Medien: beispielsweise ein Platzhaltersystem für CDs, Videos, DVDs.
Da das Handling hiefür zumeist recht zeit- und damit personalkostenkostenaufwändig ist, wird deren Einsatz zunehmend mit dem Wiederbeschaffungswert von entwendeten Medien gegengerechnet und in steigendem Ausmaß auf diese Sicherung verzichtet.
Glücklich macht das aber nicht, weil es den BibliothekarInnen in der Regel um die konkreten, in ihren Augen oft auratischen Medien leid tut, die der Bücherei verloren gehen, auch wenn ihr buchhalterischer Wert gegen Null tendieren sollte.
Der Einsatz von RFID-Etiketten versprach nun die optimale Lösung für dieses Problem zu sein.
Ein wesentliches Argument für die Einführung von RFID-Systemen war daher allemal der Sicherungsaspekt, ein Schlüsselreiz, für den vor allem Politiker, die das budgetmäßig zu bewilligen haben, überaus empfänglich sind.
Neben den Schlagworten "Personaleinsparung" und "Serviceverbesserung" ist daher "Sicherheit" wohl zu gut einem Drittel für die Pro-RFID-Entscheidung von politischer Seite verantwortlich.
Auch in keiner der Ankündigungen von Bibliothekssystemen, die auf RFID-Verbuchung umsteigen, fehlt dieser Hinweis, was vermuten läßt, dass die BibliothekarInnen den Versprechungen der Herstellerfirmen vertrauten.
In Wien gab es bis zum Abend des ersten Ausleihetages mit dem neuen System ebenfalls entsprechend hohe Erwartungen:
"beschleunigte Ausleihvorgänge, eine verbesserte Diebstahlsicherung," schreibt Bernhard Wenzl in seiner Projektarbeit "RFID in der Hauptbücherei Wien (2006)" und zitiert deren Leiter Christian Jahl: „Die neue Technologie erschien uns als Chance ... die ... Diebstahlsicherung zu vereinfachen. "
Also werden in der Hauptbücherei 300.000 Medien vertrauensvoll mit den Transponder-Etiketten beklebt und initialisiert, denn
"Diebe haben keine Chance, die eingebaute Sicherheitsfunktion macht bei einem Diebstahlsversuch laut auf sich aufmerksam: Geht man mit einem nicht ausgecheckten Buch unter der Jacke durch die Schranke am Ausgang, ruft ein Signalton das Personal herbei. So, wie man es schon aus Kaufhäusern kennt." (ChangeX)
oder:
"In der neuen Wiener Hauptbücherei piept es. Jedes Mal, wenn jemand die öffentliche Bibliothek verlassen will, die Bücher aber noch nicht den digitalen Stempel "ordungsgemäß entliehen" tragen, ertönt ein Signalton. Das schreckt Diebe ab und erfüllt somit einen der Zwecke, die die Bücherei mit der Einführung von RFID-Chips (Radio Frequency Identification) verfolgt.(In Wien funken die Bücherwürmer")
Am Abend des ersten Ausleihetages in der neuen Hauptbücherei war ein beträchtlicher Teil des DVD- und CD-Bestandes ohne Verbuchung weg. Dieser massenhafter Privatisierungsprozess hielt in den nächsten Tagen an. Hernach wurde durch einige Maßnahmen, die mit dem RFID-Sstem nichts zu tun haben, der Schwund verringert.- "Wir haben nach einem Medium für die Sicherung gesucht ..."
- "Wir sind rundum zufrieden".
- "Bis zum heutigen Tag hat der Einsatz dieser zukunftsträchtigen Technik alle Hoffnungen und Erwartungen restlos erfüllt"
Nach einiger Zeit gibt es einen Umstieg auf andere Transponderetiketten, von denen man sich bessere Ergebnisse verspricht. Die Firma Bibliotheca-RFID-Library-Systems schreibt dazu auf ihrer Website:
"Auch die Ringlabels der CDs/DVDs können gleichermaßen wie die Bücherlabels nun perfekt erkannt und verarbeitet werden. Diese Erfolge tragen Früchte: Wir freuen uns, dass ab Juni 2007 drei weitere Zweigstellen auf das BiblioChip RFID-System umgestellt haben, so dass ab September 2007 die Besucher sowie die Mitarbeiter von der neuen Technologie profitieren konnten. “
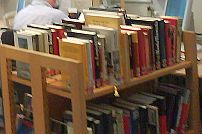
Also hockten wir MitarbeiterInnen dieser 3 glücklichen Zweigstellen im heißen Summer in the City 07 uns an die PCs und etikettierten und initialisierten insgesamt 100.000 Medien.

Gelegentlich provozieren Artikel im Falter zu der Überlegung, dem oder der Autorin einen Dolm der Woche zu verpassen. Es sind noch wenige und jene Artikel, deren VerfasserInnen ein Hero gebührt, sind noch weit in der Überzahl. Aber die Regelmäßigkeit des Aufkommens von Dolmigem erschreckt zunehmend.
Vor einiger Zeit hat beispielsweise Florian Klenk einen ganz dicken Dolm von mir gekriegt wegen der Bekanntgabe der Adresse einer KZ-Aufseherin, der jetzt der Prozess gemacht werden sollte (sie ist inzwischen verstorben). Das war "Österreich"-Level. Auch Armin Thurnherr hat schon einen eingefangen, und zwar nicht wegen seiner Gusenbauer-Elogen, sondern wegen der Beleidigtheit, mit der er auf die darauf folgende Kritik reagierte.
Auch in der aktuellen Nummer 29/08 gibt es wieder einen Dolm, sogar deren zwei. Der eine ist nochmals Florian Klenk, dessen Artikel ich an sich sehr schätze , doch dürfte ihm der Ausflug zur "Zeit" nicht so gut getan haben - warum auch immer ... Diesmal wurde er ausgezeichnet erstens wegen seines Artikels "Sima wieder gut". Schon allein die Überschrift verdient einen Sonder-Dolm und auch der Satz: "Umweltstadträtin Ullli Sima verdient das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Stadt Wien".
Der Artikel ist von einer geradezu kniefallerischen Lobpreisung der mit Witz und Intelligenz die Wiener Seele Studierenden, die mutig und konsequent die Leute in die Knie zwingt, weil sie perfekt die "vom Wiener Dialekt gefärbte Babyfäkalsprache, der von Sigmund Freud so genannten "analen Phase" anwendet.
 Nur weil tausende Schilder mit einem potthäßlichen Hund in die Grasflächen gesteckt wurden?
Nur weil tausende Schilder mit einem potthäßlichen Hund in die Grasflächen gesteckt wurden?
Zu behaupten, dass Sima mit solchen Aktionen das Hundekotproblem lösen können werde, ist fast so infantil wie die Schilder. Vergessen ist, dass die erste Staffel der Hundeschilder (das unsägliche "Gackerl ins Sackerl") innerhalb weniger Tage aus dem Stadtbild verschwunden waren, und auch viele der aktuellen Schilder liegen verstreut herum und tun das, was sie am Besten können, nämlich verschandeln.
Dabei hätte eine einfache Beobachtung gereicht, um herauszufinden, was die Hundekotsituation tatsächlich - leider noch nicht ausreichend - verbessert hat: das Anbringen von Hundekotsäckchen; es ist schnell zu erkennen, dass in der Umgebung von solchen Säckchenspendern (so sie regelmäßig nachgefüllt werden) die Fäkalienmenge deutlich geringer ist als in Gegenden, wo solche Spender nicht zu sehen sind. Ist wie mit den Mistkübeln. Sind sie vorhanden, wird reingeworfen. Sind sie nicht vorhanden, wird runtergeworfen. Ist nun mal so.
Der andere Dolm musste Barbara Tóth verliehen werden für ihren Artikel "Nur mit der Ruhe. Die FPÖ wird wahrscheinlich Teil einer nächsten Regierung sein. Na und?" Als einen der Gründe für die Aufnahme der FPÖ in die Riege der möglichen Koalitionspartner sei die demokratiepolitische Kultur [sic!] in diesem Land anzusehen:
Eine Regierungsbeteiligung der FPÖ darf nicht wieder das antidemokratische Schreckgespenst werden, zu dem es vor acht Jahren von all jenen hochstilisiert wurde, die sich die donnerstägliche Losung "Widerstand" auf ihre Fahnen geschrieben hatten. Die Vor- und Nachteile sowie die Grenzen der Koalitionsvarianten Rot-Blau und Schwarz-Blau gehören in den verbleibenden Wochen bis zum Wahltag ausführlich diskutiert - ohne Hysterisierung und Empörung, ohne die Wörtchen "Tabubruch" und "Faschismus"
Es ist nur zu dumm, wie kann man von der FPÖ reden, ohne dass man sich gezwungen sieht, sich mit Faschismus und Neonazitum auseinanderzusetzen? Und man muss es nicht als "Tabubruch" bezeichnen, was die FPÖ tut, sondern kann es auch als immer aggressivere Lügenpropaganda und Menschenhatz konkretisieren.
Das kann man, wie es Frau Tóth fordert, auch ganz cool - aber doch mit Empörung - feststellen. Aber ebenso cool ist zu konstatieren, dass jeder, dessen politische Kultur als nicht ganz verrottet angesehen werden soll, über den geregelten parlamentarischen Umgang hinaus an dieser Bande halt nicht anstreifen kann. Ist eh ganz einfach.
Ebenso einfach ist es, darauf zu verzichten, wieder beweisen zu wollen, dass diese Partei nicht regierungsfähig ist. Das war, ehe sie mitregierte, schon klar, und sie hat es dank ihres reichhaltigen Groteskpersonals auf geradezu grandiose Weise auch realiter unter Beweis gestellt.
Daher ein Pflichtdolm für die Verfasserin dieses Artikels.
Diebstahl oder klauen, um ein adäquateres Wort für das wienerische "Fladern" zu verwenden, ist in Bibliotheken und Büchereien bekanntlich kein ganz neues Thema und wird auch in den Medien periodisch abgehandelt, wenn ein aufsehenerregender Fall aufgedeckt wird oder eine neue Technik dem Buchschwund Einhalt zu geben verspricht.
Auch im Buch "Der Bibliothekar" von Gottfried Rost wird auf dieses Phänomen eingegangen. Neben einigen spektakulären Diebstahlsfällen werden aber auch Bibliothekare genannt, die wegen Bücherdiebstahls entlassen wurden. Es ist anzunehmen, dass die Tendenz zur immerwährenden Vereinigung von BibliothekarIn und Buch eine diesem Berufsstand innewohnende Konstante ist.
Denn ein Buch scheint nur für die Uneingeweihten ein selbstverständliches, triviales Ding zu sein. BibliothekarInnen wissen aber, dass es ein sehr vertracktes Ding ist, voll metaphysischer Spitzfindigkeit und psychopathologischer Mucken. Soweit das Buch nur zum Lesen benutzt wird, ist nichts Mysteriöses an ihm, aber für die BibliothekarInnen stellt es sich allen andren Gegenständen gegenüber auf den Kopf und entwickelt aus seinem Holzpapier Grillen, viel wunderlicher, als wenn es aus freien Stücken zu tanzen begänne.
(Wem diese Zeilen bekannt vorkommen, der kann hier vergleichen :-)
Es hat eine Zeit gegeben, dass diese Fetischbeziehung als eine Art Aufnahmebedingung für den Büchereidienst angesehen wurde: in meinem Ausbildungskurs hat der Vertreter der Magistratsdirektion, der uns das Dienstrecht einbläuen sollte, launig gemeint, dass er unserer Personalchefin geraten habe, bei Aufnahmetests die BewerberInnen zu fragen, ob sie schon mal ein Buch stehlen wollten. Und nur jene, die dies bejahten, seien als geeignet für den Büchereidienst anzusehen.
Vermutlich hat sich das Anforderungsprofil in der Zwischenzeit etwas geändert und ich vermute, dass die besondere Beziehung der BibliothekarInnen zum Buch zwar einen starken Antrieb zum Fischen im eigenen Bibliotheksbestands erzeugt, der soziale Antrieb in der Regel aber ungleich größer ist und daher unverbuchte Entnahmen durch Bibliotheksangestellte vergleichsweise unterdurchschnittlich oft erfolgen.
Was aber nicht heißt, dass die Medien auch immer entsichert sind, die sie für sich verbuchen. Denn es gehört fast zur Begleitmusik beim Eintreten von BibliothekarInnen in eine Bücherei, dass der Warnton erklingt. Passiert dies während der Ausleihe, lassen spöttische Blicke und Bemerkungen zumeist nicht lange auf sich warten ...
Wie man sieht, für Büchereibedienstete braucht es keine Mediensicherung bzw. wäre sie sinnlos. Hier greift in weit höherem Maße das soziale Gewissen.
Anders scheint es allerdings bei jenen zu sein, für die das Herz der sozialen BibliothekarInnen schlägt, bei den BüchereibenutzerInnen.
Dazu demnächst.
"Ich habe keine Präferenz für niemanden, wenn sie unsere Ideen mittragen", meinte Fekter bei der heutigen Pressekonferenz auf die Frage zu möglichen Partnern.(ORF)
und:
Sie habe bereits einmal Koalitionspakete im Justiz- und Sicherheitsbereich mit den Roten, Grünen und auch mit den Freiheitlichen geschnürt. (Standard)
Vielleicht sollte bei jeder berechtigten und berechtigt aggressiven Kritik gegenüber der Sozialdemokratie in ihrer heutigen Erscheinungsform gelegentlich nicht darauf vergessen werden zu betonen, dass unangefochten die widerlichste Partei in Österreich nach wie vor diese ÖVP ist; und dazu braucht es gar nicht mal den Wahnwitz, die Schottermitzi zur Innenministerin zu machen.
Die widerlichste Partei trotz FPÖ und BZÖ - denn bei denen ist klar, wo sie stehen, im aufgewirbelten braunen Schlamm und was sie wollen; so gesehen kann man sie als so etwas wie die ideale Referenz-Wunschpartei ansehen: sie erinnern an jenes Kleid im Geschäft, von dem nach dem alten Witz die Kundin der Verkäuferin sagt: "genau das Gegenteil von diesem Kleid hätte ich mir vorgestellt!"
Und auch das Personal, das diese Parteien hervorbringt, läßt sich mit dem Begriff "widerlich" gar nicht bezeichnen. Die Gestalten sind entweder retrobraun oder kommen als geistige Fönwelle daher, jedenfalls nur jenseits, um die Falterkategorie zu verwenden.
Das Widerliche der ÖVP dagegen ist unbeschreiblich, es ist so wie ein inneres Strahlen eines faulen ekligen Kerns, geeignet für einen Fantasyroman, denn es umfasst mehr als die brutale Klientenpolitik, die pfäffische Verschlagenheit, das penetrante Volksdümmeln (siehe die musikalischen Auftritte mit Pater Wilhelm, Abt Wolfgang und Lisl, der Querflöte), den Wortbruch als gelebte Politik usw., es ist als Ganzes, wie es Theodor Wiesengrund mal gesagt hat: "das Unwahre". Er kannte wohl die ÖVP durch seine Wienbesuche bei der Lotte Tobisch und antizipierte eventuell die jetzige Gestalt dieser Partei, die ja noch nie sonderlich sympathisch gewesen ist.
Daher ist zu wünschen, dass Schottermitzis keine Präferenz für niemanden zum Tragen kommt, insofern sich logischerweise niemand von ihr angesprochen fühlen kann, egal welche Pakete sie für wen schnürt.
Es wird allmählich Zeit für eine ÖVP-freie Regierung, auch wenn der ehemalige Journalist P.M. Lingens anderer Meinung ist; aber der kann ja leider nicht mehr seine Mutter fragen, die hätte ihn sicher zur Schnecke gemacht ...
Nach einem dreiviertel Jahr in Gesellschaft von Selbstverbuchungsautomaten mit einem stagnierendem Anteil von 17-19% an den Gesamtentlehnungen, nach stetigem Ärger mit störrischen Transpondern und stotterndem Bildschirmaufbau bei der Theken-Verbuchung sowie anderen netten berufsbegleitenden Erscheinungen, neigt auch der beflissendste, tunnelblickendste Büchereibedienstete dazu, sich kundig machen zu wollen. Nämlich ob dieses Zeugs, das bisher mehr Arbeit gebracht hat und langsamere Verbuchungsvorgänge, sowie jede Menge Fehlalarme, und damit einhergehend unzufriedene BüchereibenutzerInnen produziert, anderswo besser funktioniert.
Erste Google-Ergebnisse strotzen voll eitler Wonne und Zufriedenheit: egal ob es die Kosten sind, das Handling, die "Kunden"zufriedenheit - der Einsatz von RFID in Bibliotheken lässt offenbar nur frohe Bibliothekarinnen zurück.
Notorische Nörgler mögen vielleicht vermerken, dass die meisten dieser positiven Stellungnahmen entweder von VertreterInnen jener Firmen kommen, die an dem Ganzen was zu verdienen haben oder von jenen, die für den Ankauf verantwortlich sind bzw. davon leben, wie BibliotheksdirektorInnen oder EDV-Referentinnen etc.
Die wenigen Hinweise, dass sich audiovisuelle Medien nicht immer so ganz super mit Transponderetiketten vertragen, scheinen sich in der täglichen Praxis offenbar nicht auszuwirken, denn sonst wäre der angebliche Geschwindigkeitsvorteil bei der Verbuchung nicht gegeben und der anderswo bis zu 90%ige Anteil an von den BibliotheksbenutzerInnen selbst verbuchten Medien nicht möglich.
Warum klappt es nun überall und nur bei uns nicht? Ist es das miese Karma der Belegschaft wegen der Nichtbefolgung des Rates der Arbeitsmedizinerin, die uns bei ihrem Besuch die regelmäßige Einnahme von Zitronengrastee - sie empfahl Teesäckchen vom Hofer (="Aldi)" - ans Herz legte sowie die Lektüre der 5 Tibeter, als wir auf den durch die vielen Geräte erzeugten Dauergeräuschpegel hinwiesen und auf die doch recht beträchtliche Abwärme?
Oder fehlt es an der nötigen Ausdauer, wenn das Selbstverbuchungsgerät zum xten mal Timeout hat oder die Leserinnen zur Theke jagt, weil irgendwas nicht in Ordnung sein soll? Worauf sie kleinmütigerweise künftig dieses innovative Gerät meiden?
Da bekanntlich in solchen Fällen, wenn die Gegensätze ihre lebendige Beziehung und Wechselwirkung verloren haben, das Bedürfnis der Philosophie entsteht, wie es Herr Hegel mal formuliert hat (wahrscheinlich in dem Augenblick, als das Sicherungsgate höhnisch lospfiff,  als er mit zwar verbuchten, aber durch das heimtückische Selbstverbuchungsgerät nicht entsicherten Medien durchschreiten wollte, sodass sich alle Augen dem armen Herrn Hegel zuwandten und ein Bibliothekar ihn herrisch zu sich winkte?), will ich an die Sache theoretisch herangehen und greife berufskrankheitsbedingt zu einem Buche: "Anwendung von RFID-Systemen" von Christian Kern. Aufschluss über die Ursachen unseres Versagens fand ich da zwar auch nicht. Aber eine Zeichnung im Buch machte mir deutlich, dass es offenbar anderer Bibliothekare bedarf, um die Verbuchung so zu tätigen, dass sie doppelt so schnell ist wie die Verbuchung mit Barcodes. Denn die fürs Funktionieren notwendige Entfernung der RFID-Antenne zu den anderen Geräten wie PC, Tastatur, Bildschirm, Maus, Kassenbondrucker, muss laut Buch und Zeichnung so groß sein, dass es ausreichender Armlängen bedarf, um alle diese Gegenstände beim Verlauf der Verbuchung auch zu erreichen (das Bunte ist von mir zwecks besserer Anschaulichkeit hinzugefügt worden):
als er mit zwar verbuchten, aber durch das heimtückische Selbstverbuchungsgerät nicht entsicherten Medien durchschreiten wollte, sodass sich alle Augen dem armen Herrn Hegel zuwandten und ein Bibliothekar ihn herrisch zu sich winkte?), will ich an die Sache theoretisch herangehen und greife berufskrankheitsbedingt zu einem Buche: "Anwendung von RFID-Systemen" von Christian Kern. Aufschluss über die Ursachen unseres Versagens fand ich da zwar auch nicht. Aber eine Zeichnung im Buch machte mir deutlich, dass es offenbar anderer Bibliothekare bedarf, um die Verbuchung so zu tätigen, dass sie doppelt so schnell ist wie die Verbuchung mit Barcodes. Denn die fürs Funktionieren notwendige Entfernung der RFID-Antenne zu den anderen Geräten wie PC, Tastatur, Bildschirm, Maus, Kassenbondrucker, muss laut Buch und Zeichnung so groß sein, dass es ausreichender Armlängen bedarf, um alle diese Gegenstände beim Verlauf der Verbuchung auch zu erreichen (das Bunte ist von mir zwecks besserer Anschaulichkeit hinzugefügt worden):
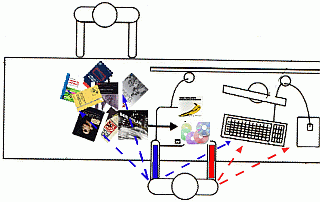

Vielleicht sollte dies in der Ausbildung künftiger Büchereibediensteter beachtet werden.
Beispielsweise die Abhaltung von Hängeseminaren:
 oder
oder  oder
oder 
Auch die Eignungstest sollten entsprechend adaptiert werden und das wesentliches Aufnahmekriterium das Türanklopfen in aufrechter Körperhaltung sein (natürlich würde es sich dabei um eine im Boden eingelassene Falltüre handeln):

BibliothekarInnen müssen flexibel sein. Ich hoffe, auch wir werden es noch lernen.
wo angeblich Hase und Fuchs einander Gute Nacht sagen; was hiermit bewiesen ist:
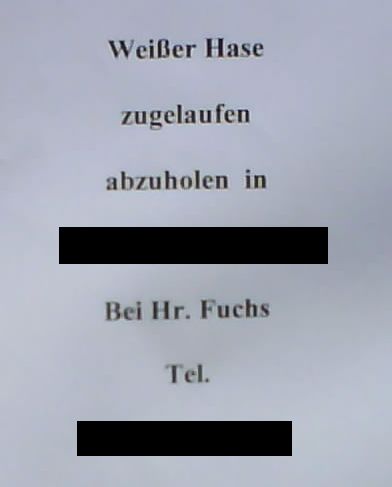
Ein offenbar bereits im tiefen Inneren der SPÖ-Wien (Stadträtin + Magistratsdirektion + FSG-Spitze) akkordiertes neues Dienstrecht für die Bediensteten des Magistrats liegt nun zur Begutachtung auf. Wie so oft werden wichtige und konfliktträchtige Materien im Sommer frei gegeben, wenn die Gremien und die Fraktionen nur unzulänglich in der Lage sind, dazu rechtzeitig und adäquat Stellung zu nehmen. Von einer innergewerkschaftlichen Diskussion ganz zu schweigen.
Der Text des Entwurfs::

Und hier die Erläuterungen.
Beim ersten Durchlesen fällt auf, dass magistratsweit die gleitende Arbeitszeit Pflicht sein wird, was in der geplanten Form eine Schwächung des Mitspracherechts der Bedienstetenvertretung nach sich zieht. Dass der Urlaubsanspruch nunmehr in Stunden statt in Tagen gemessen wird und es möglich sein soll, in Einzelfällen einzelne Urlaubsstunden zu konsumieren. Weiters Einführung eines Vierteljahres als "Freijahr", was sicher einen Fortschritt ist, Angleichungen an EU-Arbeitszeitbestimmungen u.a.m.
Es steht zu befürchten, dass der Teufel in den Details verborgen ist.
Oder gibt es gar keinen Teufel?
Ich fürchte, in dieser Hinsicht halte ich es mit dem Papst, der an den leibhaftigen Teufel glaubt. Oder war es der vorige Papst?
- Die Sandkiste hat abgedankt und das Schlaucherl hat die Krone:
Beherzt wie Sie sind, erheben Sie Ihre Stimme, wo es notwendig ist. Sie brauchen dazu weder Lautstärke noch Arroganz. Wenn Sie sich einmischen, dann nicht, um sich in Szene zu setzen oder andere anzugreifen, sondern um "mit Herz" das Recht Schwächerer zu wahren. Sie gehen mit offenen Augen durch das Leben und schauen nicht weg, wenn Sie Unrecht begegnen. Sie würden es niemals zulassen, dass in Ihrer Gegenwart Kinder, Frauen oder machtlose Minderheiten entwürdigend behandelt werden. Ihre mutige Vorgangsweise erfordert viel Selbstsicherheit. (Typ C "Der Beherzte". diesen Typus verkörpern 74% der KronenzeitungsleserInnen nach dem Ergebnis des Krone-Sonntagsbeilagenpsychotests "Wie beherzt sind Sie?")
- Auch Robert Misik hat ein Hohelied auf den neuen Spitzenkandidaten verfasst:
Der sozialdemokratische Realist. Zur Physiognomie eines Menschenschlags, der stets an der Wirklichkeit scheitert. - Unter den Sozialdemokraten trifft man nicht selten jene „praktische Männer“, die sich für „Realisten“ halten. Es ist nicht so, dass der „Realist“ Treue zu politischen Werten grundsätzlich ablehnt. Es ist auch nicht so, dass der „Realist“ nicht selbst den Werten der Sozialdemokratie „grundsätzlich“ anhängt. Der „Realist“ wäre auch durchaus für eine Politik, die mehr soziale Gerechtigkeit herstellt, er meint auch keineswegs, dass gut integrierte Immigranten und deren hier geborene Kinder abgeschoben werden sollen, auch er findet es unschön, wenn Abgeschobene bei ihrer Außerlandesschaffung ersticken und auch der „Realist“ schürt die niederen Instinkte der Menschen nur mit Widerwillen, ja, er würde sich ehrlich freuen, wenn es solche niederen Instinkte nicht gäbe und wenn er es nicht nötig hätte, ihnen zu schmeicheln. „Eigentlich“ ist er ja auch für die EU, „eigentlich“ ist er ja auch für ein liberales Strafrecht, „eigentlich“ ist er ja auch für eine lebendige Demokratie. Der ganze Artikel ist hier zu finden oder im Standard.
Ich will mir einen Rest an Selbstachtung bewahren und nicht jede Beschädigung meines öffentlichen Standings auch noch mit Argumenten wegerklären, an die ich selbst nicht mehr glaube. Ich habe nicht vor, in dieser Woche von der Klubführung zum dritten Mal in einem Jahr gezwungen zu werden, gegen meinen eigenen Antrag auf Abschaffung der Studiengebühren zu stimmen.
Und für jene, die laut Karl Kraus mit Österreich alles gemein haben außer der Sprache: "Schlaucherl" = listiger Mensch, Schlaumeier, Schlawiner
Das oft gebrauchte Wort, dass die politische Realität die Kabarettisten und Satiriker ratlos mache, scheint nun tatsächlich Wirklichkeit geworden zu sein. Selten noch habe ich einen so laschen Artikel wie den heutigen von Thomas Maurer im Kurier gelesen: er gibt einfach wieder, was geschehen ist. Was unter normalen Umstände urlustig gewesen wäre. Doch die Umstände sind nicht normal. Der Schwenk der beiden Putschisten ins nationaldumpfe Lager kam selbst für jene überraschend, die ihnen sowieso schon ziemlich alles an politischer Blödheit und Charakterlosigkeit zutrauten. Also auch für mich.
Putschisten deshalb, weil Feymann bislang keinerlei Mandat als Parteivorsitzender hat. Nicht mal als geschäftsführender. Denn im Falle eines Rücktritts des Vorsitzenden kann nur einer der bisherigen Stellvertreter zum bis zum nächsten Bundesparteitag die Geschäfte führenden Vorsitzenden gemacht werden. Faymann war aber keiner der Stellvertreter und er wurde auch durch kein Gremium ernannt. Auch Doris Bures ist nicht, wie vorgeschrieben, vom SPÖ-Bundesvorstand zur Bundesgeschäftsführerin bestellt worden. Eine "Virtuelle SPÖ-Spitze" nennt dies Daniela Kittner im heutigen Kurier.
Mit wem sich die beiden Herren Putschisten ins Bett legen, war ihnen sicher bekannt, es wurde ihnen auch in der heutigen Kronenzeitung gezeigt, was ihnen blüht, wenn sie vom nationaldichandschen Kurs je abzurücken wagten. In der sich "Strudl" nennenden Kolumne gibt es einen Kommentar zum über alle Parteigrenzen hinweg hoch angesehenen EU-Abgeordneten Herbert Bösch, allgemein bekannt als immens fleißig und integer:
"A roter EU-Parasit namens Bösch kritisiert den SPÖ-Brief an den Hans Dichand 'Ich bin seinerzeit nicht der Kronenzeitung beigetreten. sondern der Sozialistischen Partei Österreichs.' Allerdings, I glaub nämli kaum, dass die Krone den gnommen hätt!"
Der künftige Koalitionspartner der NSDAP, die Effen, haben schon die nächste Vorgabe gemacht: Strache fordert, dass die 22 Sozialversicherungsanstalten auf zwei zu reduzieren wären: eine für Österreicher, eine für Ausländer.
Dem notorischen Aufdecker Peter Pilz ist bereits die künftige Ministerliste der NSDAP zugespielt worden, die da lautet:
Justizminister: Peter Gnam
Verteidigungsminister: Ernst Trost
Sozialminister: Kräuterpfarrer Weidinger (via Lotte Ingrisch)
Bildungsminister: Herr Strudl
Frauenminister: Michael Jeannee
Infrastrukturminister: Werner Faymann
Finanzstaatssekretär: Wolf Martin
noch ein Staatssekretär: Dieter Kindermann
Bundeskanzler: Hans Dichand
Und Rainer Nikowitz im Profil hat sich als Schlüssellochjournalist betätigt:
Gusenmann und ihr EU-Brief an den Herausgeber der „Krone“ – die packende Schlüsselloch-Story.
Dichand: Ja, servus Werner, mein Bub. Dass d’ mich du wieder einmal besuchen kommst! Des muss ja eine Ewigkeit her sein … Wann hamma uns des letzte Mal gsehn?
Faymann: Des war gestern, Onkel Hans.
Dichand: Kinder, wie die Zeit vergeht! Wer is denn der Komiker da?
Faymann: Des is der Bundeskanzler, Onkel.
Dichand: Bundeskanzler, soso. Aber war des net immer so ein Schmalpickter?
Gusenbauer: Des war mei Vorgänger.
Faymann: Und der Fredl is mei Vorgänger.
Gusenbauer: Des is aber no net ausgmacht.
Faymann: Zwischen dem Onkel Hans und mir scho.
Gusenbauer: Äh …, Herr Dichand, mir wären da wegen dem Text.
Dichand: Des is aber lieb, dass ihr mir helfen wollts, Buben, aber i hab ihn für heut scho fertig. Schauts einmal, da is er: Bei dieser Hitze schwört Nadine (19) auf ein altes Hausmittel von Kräuterpfarrer Weidinger – sie reibt sich die Brustwarzen mit Eiswürfeln ein und …
Faymann: Onkel, wir meinen den Text von dem Brief. Wegen der EU.
Dichand: Ah ja! Die EU! I freu mich, dass ihr endlich vernünftig werdets.
Gusenbauer: Ich möchte aber jetzt schon vorausschicken, dass ich immer noch für ein vereintes Europa bin.
Dichand: Burschi, i war scho für ein vereintes Europa, wie du no in der Nudelsuppen gschwommen bist. Und damals war des no net so modern wie heute.
Faymann: Meinst du 1994?
Dichand: Fast. 1944.
Gusenbauer: Wenn des scho so anfangt, werden wir da jetzt in der Diskussion auf keinen grünen Zweig kommen.
Dichand: Diskussion? Wovon redet der bitte?
Faymann: Sei ihm net bös, Onkel Hans, er meint des net so. Er is halt manchmal a bissl hoppertatschig.
Dichand: So? Na gut. Fang ma an. Du …, Dings da …, was is er noch amal, Werner?
Faymann: Bundeskanzler.
Dichand: Ah so, genau. Also, Bundeskanzler, du setzt dich da her und nimmst den Diktierblock.
Gusenbauer: Bin i a Sekretärin?
Dichand: Na ja, nein. Aber in der Not frisst der Teufel Fliegen. Und du Werner … Mein Hund is heut net da. Aber i brauch was zum Streicheln, wenn ich aus dem Vorhof der Macht goldene Worte in die Welt da draußen entlasse. Leg dich neben den Schreibtisch, schau mich lieb an und hechle ein bisserl.
Faymann: Okay.
Gusenbauer: Des machst du wirklich? Des is ja unpackbar!
Faymann: Eh. Weil du macherst ja nie alles, nur damit du Bundeskanzler bleibst.
Gusenbauer: Hab i scho erwähnt, dass i recht gut Steno kann, Herr Dichand?
Dichand: Da schau her! Na dann stenografier: Sehr geehrter Herausgeber!
Gusenbauer: Sollt man net lieber so was schreiben wie: Liebe Mitbürgerin, lieber Mitbürger?
Dichand: Werner? Der Kerl nervt.
Faymann: Tschuldigung, Onkel Hans … hehehehe … aber er … hehehehe … er weiß scho, dass du der erste Bürger im Staat … hehehehe …
Dichand: Was machst denn für komische Geräusche?
Faymann: I hechle. Du wolltest es so.
Dichand: Ich? So ein Blödsinn. Und jetzt mach Platz.
Gusenbauer: Also gut. I schreib: Sehr geehrter Herausgeber! Aber über den restlichen Inhalt müss ma trotzdem noch reden.
Dichand: I hör immer nur reden. Worüber? Ihr seids jetzt auch für eine Volksabstimmung über den EU-Vertrag, die „Krone“ hat damit wieder einmal einen rauschenden Erfolg für das darbende Volk erzielt, und alle san glücklich.
Faymann: Aber wir san net für a Volksabstimmung über den jetzigen Vertrag, Onkel. Den hamma scho beschlossen.
Gusenbauer: Genau. Des gilt nur für zukünftige Verträge.
Dichand: Aber es wird keine zukünftigen Verträge geben.
Faymann: Eh net.
Gusenbauer: Um Gottes willen, des brauchert ma no! Stell dir vor, Werner, wir müssten wirklich eine Volksabstimmung machen und die ganzen Koffer …
Faymann: Des meint er auch net so, Onkel Hans.
Dichand: Dann lassts mi des einmal richtig verstehen: Der Brief hat eigentlich keinen anderen Sinn, als dass ihr öffentlich meinen Speichel leckts?
Gusenbauer: Ja.
Dichand: Ich halt ja an sich gar nix von heuchlerischem Geschmeichel.
Gusenbauer: Net? Der Werner hat gemeint …
Dichand: Außer natürlich, der Adressat bin ich. Und dass ihr die „Krone“-Leser für deppert verkaufts, das is …
Faymann: … na ja, ein kleiner taktischer Schachzug …
Dichand: … großartig! Besser könnt i’s ja selber net. I bin so begeistert, i muss mir nachher gleich zwei, drei Leserbriefe schreiben.
Gusenbauer: Schön, dass wir uns einig sind. Fang ma jetzt an?
Dichand: Gleich. Vorher haben der Werner und ich noch was zu erledigen. Na komm, Burli, gemma gschwind Gassi. Na wo hat er denn seine Leine, der kleine Racker, ha?
Faymann: Pfah, Onkel Hans! Kömma heut wenigstens in den Hof gehen, wo uns kana sieht?
Dichand: Nix da. Wir gehen vorn auf die Straßen.
Faymann: Na ja. A scho wurscht.
Mehr fällt "mir" zu Gi-Ga-Gusemann nicht ein.
Zum Glück gibt es aber andere. Im stets lesenswerten Kellerabteil werden Kommentare zusammengetragen und u.a. auch auf die Hinweise von adresscomptoir verwiesen.
Bei dieser Gelegenheit ist mir ein Satz im Kellerabteil untergekommen, der wohl auch für Ereignisse wie diese gilt und der bei Gefahr des in einen abgehobenen Zynismus Driftens immer wieder in Erinnerung zu rufen wäre:
dass wir konsequent üben sollten, dem drang nach einer abschätzig abgeklärten haltung NICHT nachzugeben, training darin, uns sehr wohl zu echauffieren, im privaten, in unseren halbprivaten öffentlichkeiten der näheren umgebung und in der öffentlichkeit, in der wir als bürger aufbegehren, wenn uns solche eben-nicht-belanglosigkeiten vorgesetzt werden.
wir haben kein recht der gleichgültigkeit.
Ich kam, ich schaute, und was ich sah, war Vista. Natürlich wurde der neue PC mit vorinstalliertem Vista geliefert. Der Versuch, mit vistaeigenen Mitteln Partitionen freizuschaufeln für FAT32, gelang mal nicht. Da hab ich erst mal geschaut, mich aber nicht sonderlich gewundert. Probieren, ob XP dazu zu installieren geht. Also die XP-Scheibe vom anderen PC reingelegt und - visda teifi hom wü - das nächste blöde Schaun: geht nur mit dem anderen Fabrikat. Könnte noch den Zweitausender nehmen, der hat aber irgendwie beim Installieren immer Manderln gemacht, ich glaub, der braucht ein Achtunneunziger vorher. Aber das Achtunneunziger braucht sicher ein Fünfunneunziger, daran kann ich mich noch erinnern und bis ich die Scheiberln zusammengesucht habe, schwimmt sicher schon Vienna mit dem Cover nach oben die Donau runter.
O.k., her mit Suse. Partitionierte wie gewollt, ließ sich mit einigen Mätzchen, die mich misstrauisch hätten machen sollen, installieren, startete auch, fand aber keine Verbindung zum Internet. Die Überprüfung der Eintragungen zeigten, dass Suse sich sowas von nicht ausgekannt hatte, was es machen sollte, dabei hat es sich auf den anderen Rechnern schon mehrmals, ohne nur mit dem digitalen Wimper zu zucken, installieren und verbinden lassen. Nach der Korrektur der Einträge - nix da. Kein Internet. O.k., starte ich über den Grub dann das noch immer da seiende Vista und such mir Hilfen. Vista startete nicht, sondern ließ mir mit seinen kryptischen Fehlermeldung was anschauen, was ich nicht kapierte. Unter den Tisch gekrochen, umgesteckt und mit dem alten Kübel flennend zu Tante Google, die mir streng aber ausführlich erklärte, dass Vistas Bootmanager anders sei als die früheren Versionen und von Grub gerne überschrieben werde, wenn man nicht aufpasse. "Schau, Vista!", sagte ich, "es war ein kurzes Gastspiel, es hat mich nur wenig gefreut, jedenfalls: ¡ hasta la vista, altes baby! Und foi ned!"
Eigentlich brauch ich eh nur Achtundneunziger für die wenigen Windowsanwendungen, die ich noch verwende. Also stecke ich die Startdiskette ins Diskettenlaufwerk und installiere es in Gottes Namen. Welches Diskettenlaufwerk? Eben.
Linux will immer noch nicht ins Internet, mit einigen Eintragungen im Grub kann ich dann aber ein recht zerschossenes Vista aufmachen und nach einigem hin und her sogar das Factory Image starten.
Erniedrigt und beleidigt sah ich Vista bei der Wiederherstellung zu und erlebte den puren Selbsthass, als ich Glücksgefühle in mir wallen spürte, als der Vista-Eröffnungsbildschirm mich nach 10 Tagen wieder begrüßte. Denn das oben Beschriebene hat natürlich mit zahlreichen Unterbrechungen stattgefunden und auch die einzelnen Schritte waren für sich schon Zeitkiller. Die Politiker sollten bei ihren geplanten Pensionszeitverkürzungen mal überlegen, wie die Nettolebenserwartung eigentlich ausschaut, wenn man jene Zeit als tote Zeit rechnet, die von Microsoft beansprucht wird. Ich vermute, dann sind wir bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung, die jenen der Menschen irgendwann im 17. Jahrhundert entspricht.
Was Windows aus Menschen alles machen kann!
Wenn nicht Kill-Bill-Wartke gewesen wäre, hätte ich wohl nimmer mehr Trost gefunden in diesem meinem zeitlich devastierten (devistaierten?) Leben.
Und jetzt geh ich an die Sachen, die mich seit 10 Tage vorwurfsvoll anvisieren, anvisitieren, anstieren ...
Aunque la mona se vista de seda, mona se queda.
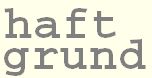
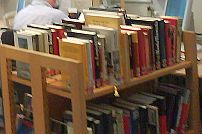


 als er mit zwar verbuchten, aber durch das heimtückische Selbstverbuchungsgerät nicht entsicherten Medien durchschreiten wollte, sodass sich alle Augen dem armen Herrn Hegel zuwandten und ein Bibliothekar ihn herrisch zu sich winkte?), will ich an die Sache theoretisch herangehen und greife berufskrankheitsbedingt zu einem Buche:
als er mit zwar verbuchten, aber durch das heimtückische Selbstverbuchungsgerät nicht entsicherten Medien durchschreiten wollte, sodass sich alle Augen dem armen Herrn Hegel zuwandten und ein Bibliothekar ihn herrisch zu sich winkte?), will ich an die Sache theoretisch herangehen und greife berufskrankheitsbedingt zu einem Buche: 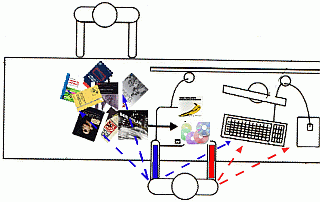

 oder
oder  oder
oder