Nach der Wiedereröffnung der Bücherei sehen die BenutzerInnen ein Gate, das unschwer als Alarmauslöser erkennbar ist.
Von den bisher 3 Ausleihetheken stehen nunmehr 2 zur Verbuchung zur Verfügung plus 2 Selbstverbuchungsautomaten. Der 3. Arbeitsplatz ist ab nun nur noch zur Einschreibung und für Information sowie für die Hilfestellung bei den Selbstverbuchern vorgesehen.
Diese Hilfestellung besteht vorerst vor allem darin, die Botschaft Selbstverbuchung zu verbreiten:
- Selbstverbuchung ist eine Erleichterung für die BenutzerInnen
- Die Bücherei kann jetzt länger offen haben
- Man muss sich nicht mehr bei der Theke anstellen
- Die Selbstverbuchung ist für die Ausleihe gedacht
- Nein, nicht für die Rückgabe
- Rückgabe, Abholung vorbestellter Medien und Begleichung von Gebühren sind weiterhin thekenpflichtig. Gebühren können aber auch erst bei der Rückgabe beglichen werden
- Außer der Kontostand ist bei 12 € offene Gebühren angelangt - dann muss vor der Selbstverbuchung bei der Theke bezahlt werden
- Verlängerungen gehen zwar übers Internet, jedoch nicht über die Selbstverbucher
- TagesleserInnen müssen auch zur Theke
- DVDs müssen vor der Entlehnung zuvor gegen die Covers ausgetauscht werden
- CD-Roms auch
- Bei Überschreitung der Höchstzahl der Medien ist keine Selbstverbuchung möglich. Kann aber im Bedarfsfall an der Ausleihetheke überschritten werden
- Abgelaufene Ausweise oder Ausweise zur jährlichen Wiedervorlage müssen zuvor an der Theke erneuert werden
- Am einfachsten ist es, zuerst die Medien zurückzugeben und nach dem Aussuchen von Büchern, Zeitschriften und CDs diese beim Selbstverbuchungsautomaten zu verbuchen
- Außer Punkt 5. - 13. tritt in Kraft.
Soweit die Botschaft. Demnächst die Praxis.
Bisher zum Thema:
Über den Kultursekretär Egon Rentzsch schreibt Alfred Kantorowicz im 2. Band seines "Deutschen Tagebuchs":
"Der Rentzsch dampfte vor Hochgefühl. Gerade hatte er nach der offiziellen Premiere beschlossen, ein anderes Stück zu verbieten. Er lief Amok, niemand konnte ihn stoppen.
Er überrollte alles. ... Ihm, Rentzsch, war von der Instanz, die für ihn allein zählte, dem von Ulbricht beherrschten Zentralsekretariat der SED, das grüne Licht gezeigt worden, mal 'Ordnung zu schaffen', reinen Tisch zu machen mit jeder Eigenwilligkeit der 'Tintenkulis', später hat man den Amokläufer auch abgeschoben – nicht gerade in die Wüste geschickt, denn ein Mann von seiner Roheit und Dummheit war immer mal wieder brauchbar, aber aus der Zentrale auf einen Außenposten bei den Gewerkschaften versetzt."
Der Eindruck läßt sich nicht ganz wegwischen, als ob die Gewerkschaft nie wirklich hoch im Kurs gewesen ist, wenn sie als Teil des herrschenden Systems agierte.
Was mich – wie nach fast jeder gewerkschaftlichen Ausschuss[wie-schon-der-Name-sagt]-Sitzung – an das Projekt "gewerkschaftliche Funktionen als Sekundärkarriere" erinnert, mit dem ich diesem Unmaß an Geschmeidigkeit und Dummheit von Gewerkschaftsfunktionären in höheren Positionen nachzuspüren versuchen wollte.
weil ihm nicht entgangen ist, dass er eine bestimmte Zeit unterbieten wird müssen, um Olympiasieger zu werden. Von einem seiner Mitbewerber wiederum heißt es: "Der tote Vater läuft im Geiste immer mit". Kein Wunder, dass der es ziemlich eilig hat und ein Nervenbündel sein soll. Was ihn von einem dritten Bewerber unterscheidet, der "genau genommen ein fauler Hund" ist, weil er nur widerwillig so hundert Meter vor sich hinläuft und lieber zu Hause Video schaut.
"Georgische Therapie" dagegen betreiben zwei Brasilianerinnen, von denen die eine Georgien bereits zwei Mal besucht hat: sie nennen sich je zur Hälfte so, wie Georgien auf georgisch heißt und besiegten ein russisches Team in jenem Sport, der an den Gestaden des Wörthersees gerne vorgeführt wird, weil er wegen seiner Bekleidungsvorschriften dazu angetan ist, dass die meisten der zuschauenden Männer nicht imstande sind, sich auf den Verlauf des Wettbewerbs zu konzentrieren."Wir repräsentieren Georgien mit ganzem Herzen. Ich kämpfe für euch, wie ihr dort kämpft," meinte die Brasilianerin. Die eine unterlegene Russin tröstet sich für die Niederlage damit, dass sie ohnehin nicht gegen ein georgisches Team gespielt hätten, "sondern gegen brasilianische Freunde". Die andere ist aber echt sauer und meint: "Ich bin sicher, die wissen nicht einmal, wer georgischer Präsident ist."
Und die Österreicherinnen? Sie gaben sich, was in dieser Sportart ja aufgrund des angeordneten Outfits eher unerwünscht ist, nämlich "keine Blöße", und hechteten sich körperbetont in die nächste Runde.
Noch nicht weitergehechtet hat sich einer der wenigen österreichischen Fußballvereine, der noch in einem europäischen Bewerb steht, aber immerhin: "Sturm drängt weiter nach Europa". Aber auch hier spuckt Georgien in die drängende Suppe: ein Abwehrspieler mit dem herkunftsverratenden Namen Schaschiaschwili verursachte ein Verlusttor und wurde ausgetauscht: "Vielleicht war er doch durch die Kriegswirren in seiner Heimat belastet" mutmaßt der Sportredakteur. Womit die Frühstückslektüre der Sportseiten des "Mariähimmelfahrt"-"Kuriers" ihren erschütternden Abschluss gefunden hat.
Schneller als erwartet, konnte ich die Wirkung von ekelerregenden Texten erfahren. Nämlich durch die in den Medien wiedergegebene Reaktion des technischen Direktors des Internationalen Olympischen Komitees, Gilbert Felli, auf die Entscheidung der chinesischen Verantwortlichen, bei der Eröffnungszeremonie nicht jenes Mädchen zu zeigen, welches die chinesische Hymne sang, sondern ein anderes als Synchronsängerin einzusetzen, weil die Sängerin "zu häßlich und zu dick" sei.
"Man muss sichergehen, dass die Darsteller und der Song auf dem höchsten Level sind", sagte IOC-Geschäftsführer Gilbert Felli am Mittwoch vor Journalisten.
Die Entscheidung sei von den Produzenten der Show getroffen worden und müsse "im Kontext der Eröffnungszeremonie und der Komplexität der 15.000 Künstler" betrachtet werden. Auf die Frage, wie Peiyis Eltern die Entscheidung der Siebenjährigen beibringen sollten, antwortete Felli: "So ist das nun einmal - im Sport und im Leben."
Vom chinesischen Terrorregime mit seiner Reichsparteitags-Ästhetik ist nichts anderes zu erwarten. Ein Repräsentant einer internationalen Organisation wie das IOC müsste ob solcher Aussagen umgehend rausgeschmissen werden. Doch bekanntlich ist das IOC selber ja ein ziemlich übler Haufen.
hätten die gleiche Wirkung wie Filme mit Ekelszenen oder der Genuss übelschmeckender Getränke, berichtet der SPIEGEL ONLINE:
Das geschriebene Wort kann emotional genauso aufwühlend sein wie ein Actionfilm. Das gilt zumindest für das Gefühl des Ekels, wie Mediziner um Mbemba Jabbi von der Universität im niederländischen Groningen gezeigt haben. Die Wissenschaftler präsentierten Testpersonen Film- und Textausschnitte mit widerlichen Szenen. Außerdem mussten die Teilnehmer ein übelschmeckendes Getränk zu sich nehmen. In allen Fällen sei die gleiche Hirnregion aktiv gewesen, schreiben die Forscher im Fachmagazin "PLoS One".
Für die LeserInnenberatung ergeben sich daraus vielleicht einige Anknüpfungsmöglichkeiten, auch wenn mir gerade sowas von überhaupt keine einfallen :-)
ist in GlaubeAktuell zu lesen:
Noch liegen die Werke von Karl Marx, Peter Hacks und Leo Tolstoi in Bananenkisten. Wenn sich der Traum des ehemaligen «Tatort»-Kommissars Bruno Ehrlicher alias Peter Sodann erfüllt, stehen sie eines Tages zusammen mit allen anderen zwischen 1945 und 1990 in den jetzigen neuen Bundesländern erschienenen Büchern in einer Bibliothek - jeweils ein Exemplar pro Titel. Kurz nach dem Fall der Mauer entschied sich der Schauspieler, die literarischen Zeugen der vergangenen Ära vor dem Müll zu bewahren. «Unsere Enkel werden nachfragen», sagt Sodann, der mit dutzenden Helfern in Merseburg bei Halle (Saale) bislang rund 180 000 Bücher gesammelt hat und noch lange nicht am Ziel ist.
Auslöser war der massenhafte Bruch mit der DDR-Vergangenheit, dort wo es am Leichtesten geht - bei den Büchern:
Nur eine halbe Autostunde entfernt von Merseburg waren kurz nach dem Ende der DDR tausende druckfrische Bände auf dem Müll gelandet - zum Entsetzen vieler Buchliebhaber. Die Leipziger Kommissions- und Großbuchhandelsgesellschaft, zu DDR-Zeiten zentraler Bücher- Auslieferer, hatte tonnenweise Bücher auf die Müllhalde gebracht, darunter deutschsprachige Klassiker ebenso wie Tierbildbände, moderne Lyrik oder aufwendig illustrierte Märchenbücher. Nicht nur der Großhandel, auch Privatleute und Bibliotheken trennten sich von bedruckten und gebundenen Hinterlassenschaften der DDR. ... «Wir rechnen damit, dass rund 100 Millionen Bücher aus den Bibliotheken auf dem Müll gelandet sind», sagt Eberhard Richter, Vorsitzender des «Peter-Sodann- Bibliothek e.V.».
Derzeit wird ein Domizil für die Bücher gesucht, damit diese auch zugänglich gemacht werden.
Erinnert von fern an die Rettungsaktionen von Nicholson Baker und der Gründung der American Newspaper Repository, die Originalzeitschriften auch nach ihrer Digitalisierung zu bewahren sucht - siehe auch "Der Eckenknick"(Double Fold) .
Der "Geburt des Neoliberalismus" widmet die ZEIT 33/08 einen Artikel, in dem einleitend geschrieben steht:
Vor 70 Jahren beschloss eine internationale Gruppe liberaler Intellektueller auf einem Treffen in Paris, die Welt zu ihrem Glauben zu bekehren. Es war die Geburtsstunde des Neoliberalismus
Zu einem Geburtstag gehören Geschenke und BibliothekarInnen schenken zumeist Bücher, zum Beispiel:- Michel Foucault: Die Geburt der Biopolitik, wo dieses begriffsbildende Symposium auf Seite 188ff angesprochen wird (übrigens versehentlich mit 1939 datiert). Unverzichtbar für eine Auseinandersetzung mit der Wirkungsgeschichte des "Neoliberalismus", ein Begriff, der heute wie jener der "Globalisierung" rasch dahergesagt wird und alles mögliche zu bedeuten vermag.
- Alessandro Pelizzari: Die Ökonomisierung des Politischen ist ein Einstieg zum Verstehen der Mechanismen, die dazu führen, dass funktionierende Solidarsysteme wie Bildung, Gesundheit, Altersversorgung unter das Diktat neoliberaler Logik geraten und systematisch zerstört werden. Im Öffentlichen Bereich ist das passende Werkzeug dazu das unter verschiedenen Namen eingesetzte "New Public Management".
- Wilfried Glißmann: Womit finde ich mich konfrontiert? Indirekte Steuerung im Konzern aus der Perspektive der Beschäftigten in "'Rentier ich mich noch'? Neue Steuerungskonzepte im Betrieb". Eine faszinierende Studie unter anderem daüber, wie Prozesse der Selbstorganisation der Beschäftigten unter dem "Regime" indirekter Steuerung zu internalisierten Sachzwängen gerinnen, in denen das eigene Tun stets als defizitär erscheint und die eigene Produktivität nur als Kostenfaktor wahrgenommen wird.
- Uwe Bröckling: Das unternehmerische Selbst. Soziologie einer Subjektivierungsform. Ausgehend von der Frage, wie in einer Gesellschaft, in der abweichendes Verhalten ein wünschenswertes Alleinstellungsmerkmal, noch Widerstand möglich sei, stellt Bröckling fest:
Der Sog der unternehmerischen (Selbst-)Mobilisierung lässt sich planvoll erzeugen, die Widerstände dagegen nicht. ... Es gibt eine Wissenschaft des Regierens, aber keine des Nicht-regiert-werden-Wollens. ... Daher bleiben Beschreibungen der Kunst, anders anders zu sein, stets anekdotisch. Man kann Geschichten des Nichtfunktionierens oder des Umfunktionierens erzählen, Theorien daraus ableiten kann man nicht.
Diesem melancholischem Befund setzt der Autor, wie er in einem Interview feststellt, analog zu Gramsci einen "Optimismus der Tat" entgegen und hofft auf eine "self-destroying prophecy". Bietet sehr viel Material und teilweise tiefgehende Einsichten, aber eben ohne Handlungsperspektive, die wohl auch aus diesem Kontext her nicht zu leisten ist.
- Detlef Hartmann: Cluster. Die Organisation des sozialen Kriegs. Und
Gerald Geppert. Global Player und clusterorientierte Regionalisierung. Beide in "Cluster. Die neue Etappe des Kapitalismus". Analyse des Zusammenwirken McKinseys mit der Region Wolfsburg und mit VW als Versuchslabor für "die neuen Sozialtechniken der Unterwerfung und Selbststeuerung , wie sie in den 'Arbeitsmarktreformen Hartz I-IV' staatlicherseits vorangetrieben wurden". Der Versuch der "unverbesserlichen grauen Köpfe" eine "Diskussion über neue Möglichkeitsbedingugnen des Widerstands" zu eröffnen.
Weiters ein paar Spenden von Unwörtern als Geburtstagstorten-Kerzerln:
- Portfolio - seit einiger Zeit wollen die SchülerInnen nicht mehr Hilfe für Referate oder Projektarbeiten, sondern für ihr "Portfolio". Was ich anfangs für ein saublödes Modewort hielt hat Methode, wie ich bei Hartmann (s.o.) unlängst lesen musste: der "Portfolio-Wahn" ist ein durchkomponiertes Konzept und nicht von ungefähr aus der kapitalistischen Ökonomie entnommen,
"ein Begriff für eine Sammelmappe von Vermögens- bzw. Wertpapierbeständen. SchülerInnen sollen von der Grundschule an in einer Mappe Arbeitsstände, Lernergebnisse, Qualifikationen und Arbeitsproben sammeln, laufend selbst bewerten und damit Fähigkeiten der Selbstrechenschaft, -orientierung an Leistungsmarken und -vereinbarungen, -evaluation, -steuerung, -reflexion zu entwickeln, standardisieren und vor allem für die Kontrolle ikm Sinne einer totalen Selbstüberwachung transparent machen" (Hartmann, S. 204)
Inzwischen sind bereits Kindergartenkinder Objekte der Begierde der Portfoliomanie.
- KundInnen, Kundenorientierung - alle und jede/r werden zu KundInnen. Die BibliotheksbenutzerInnen für die BibliothekarInnen, diese wieder für die EDV-Abteilung. welche ihrerseits an die EDV-Firmen Aufträge erteilt, die vom "Kunden BibliothekarIn" gemeldeten Defekte zu reparieren, damit die KundInnen BüchereibenutzerInnen wieder einen funktionierenden Opac haben, und somit ein positives Feedback über den Dienstleister Bibliothek geben, was die BibliothekarInnen in die Lage versetzt, auch dem Dienstleister EDV-Abteilung eine günstige Rezension zu verpassen, worüber sich die EDV-Abteilung freut und in ihrem Leistungsbericht vermerkt, womit künftig neue KundInnen sowohl aus dem magistrats- als auch aus dem privaten Wirtschaftsleben gewonnen werden sollen. Erwähnte ich schon, dass seit 5 Wochen in unserer Bücherei ein toter KundInnen-PC steht?
Aus dem Obigen lugt schon das nächste Unwort hervor:
- Evaluierung - beispielsweise wenn es darum geht, Büchereien erweiterte Öffnungszeiten zum Nulltarif aufzuschwatzen, wie bereits anhand eines konkreten Evaluierungsprozesses beschrieben.
Als Geburtstagsständchen für das greise Geburtstagskind, für das es hoch an der Zeit ist, in den Himmel der Hayek, von Mises, Friedman, Pinochet und Reagan einzukehren, schlage ich folgendes aus dem Vorwort von "Cluster" vor:
"Wissen sei Macht, hat vor 100 Jahren ein Arbeiterführer gesagt - die Wissensproduktion in McKinsey-Zeiten scheint hingegen den Möglichkeitsraum und Möglichkeitssinn des je einzelnen bis auf einen schmalen Korridor zugestandener Wahlalternativen zu verengen. Sie setzt immer schon Anpassung und Angleichung subjektiver Potentiale und Fähigkeiten voraus, die darum systematisch von Kindesbeinen an domestiziert, beschnitten und auf das Wettbewerbsfähige hin formiert werden - manchmal sogar in besten 'erzieherischen Absichten'. ... Wir sollten ein aktives Interesse an einer neuen Dialektik der Wissensproduktion formulieren, die Chancen eröffnen könnte, dass Möglichkeitsräume und -sinne wieder gedehnt und geöffnet werden. ... Unsere Aufgabe könnte es sein, angesichts der technologisch erzeugten grenzenlosen Scheinmöglichkeiten antithetisch auf dem authentischen Bezug zum Sozialen zu beharren. ... Die Zeit läuft gegen uns. Aber, dass es 'so weiter ginge', wäre, nach Walter Benjamin, die Katastrophe. Haben wir eine Wahl, Sisyphos?
Aus einer bildungspolitisch für gewöhnlich hart an der Zuverlässigkeit schrammenden Quelle ist zu entnehmen
Ron Wood (61) kann einfach nicht die Finger von seiner Ekaterina (19) lassen. Jetzt lud er sie sogar in seine Entzugsklinik ein - zum sexy Stelldichein in der Bücherei. (...)
Da scheint jemand von der Kamapagne "Treffpunkt Bücherei" nachhaltig sozialisiert worden zu sein. Bei der folgenden InformationZum Schäferstündchen schlossen sich Ron und "Kat" in die Bibliothek ein
stellt sich einem als Angehörigen der Berufsgruppe umgehend die Frage: was macht inzwischen das bibliothekarische Personal? Geht es mittagessen oder bleibt es in der Bibliothek und widmet sich der Fortbildung? Auch der nächste Satz wirft Fragen auf:Was wohl Rons Ehefrau Jo (53) zum Bücher-Tête-à-tête ihres untreuen Gatten sagt?
Heißt "Bücher-Tête-à-tête", dass sie sich doch auch mit Büchern und nicht nur miteinander konfrontiert hatten? Oder sollte das generationenübergreifende Paar vielleicht frevelhafterweise Bücher als Unterlage für sein Tête-à-tête verwendet haben, weil auf alten Steinen liegt es sich vielleicht nicht so gut?
Wie auch immer, in Wien wäre sowas nicht passiert. Dort gibt es bekanntlich seit einigen Jahren keine Spitalsbüchereien mehr, weil die zuständige Stadträtin der Meinung war, dass die Spitäler für die Büchereien selbst aufzukommen hätten, wenn sie welche wollten.
Die Spitäler sahen das anders und Ron Wood hätte für die Betätigung seiner Finger eine andere öffentliche Örtlichkeit finden müssen.
Dabei wäre das doch ein netter Aufmacher mit Bild für die "Rathauskorrespondenz" gewesen:"Stadträtin Laska übergibt Rolling Stone den Schlüssel der Spitalsbücherei!!"
SPIEGEL: Tatsache ist, dass Ihr Boss schon im vergangenen Jahr über 60 Millionen verdient hat. Gibt es eine Grenze, von der an Managereinkünfte unanständig werden?
Hück: Unanständig ist es, wenn Manager Werke schließen, Mitarbeiter entlassen und dann persönlich noch enorme Gehälter kassieren. Da gehe ich auf die Barrikaden. Wir haben eine ganz andere Situation.

fragte zurecht der Kronenzeitungschef in einer sogar von ihm selber gezeichneten Stellungnahme. Gemeint war der Faymann/Gusenbauer-Brief, der dem Gusenbauer das innerparteiliche Gnack gebrochen und dem solitären Grinsen der Cheshire Cat zum Sprung an die Spitze verholfen hat. Ansonsten warnte Dichand einen Kolumnisten seines Blattes, dass dieser mehr auf seinen ungebärdigen Vater aufpassen müsse, sonst könne es ihm gehen wie anderen zuvor. Und dann bekannte der Patron Österreichs in seiner verklausulierten Schreibweise, dass er die Leserbriefe nicht mehr selber zu schreiben braucht, sondern dafür 3 Angestellte abgerichtet hat.
Marga "Geliermasse" Swoboda ihrerseits heftet sich in der selben Gratisausgabe vom 3. August an die Fersen des Grinsens und berichtet darüber auf einer Doppelseite mit dem neckischen Titel: "Faymann wird der Marsch geblasen":
- und immer wieder ein Lacher, der wie eine Lokomotive das kleine Begleitteam bei Morgenfrische hält
- und ein Lachen überzieht das Gesicht, so Mecki-keck
- zeigt ihnen seinen Respekt, indem er auf jeden Schleim in seiner Rede verzichtet
- Laura Rudas, die junge Rote im Team Faymann, die sich zur ungezähmten Haltung ausdrücklich ermuntert fühlen darf
- wie ein Zeitsprung zurück in die Hoffnung
- mit steirischem Herzblut stellt er seine Tochter Elisabeth als Spitzenkandidatin vor
- eine Gänsehaut möchte aufkriechen in der überhitzten Halle
But it's all right, Ma, it's life, and life only
Das Bibliotheksportal hat einen in den USA entwickelten "Bibliothekswertrechner" adaptiert und bietet ihn für Bibliotheken und Büchereien für ihre Webauftritte zum Download an, denn:
Der Wert Ihrer Bibliothek ist ja eigentlich unschätzbar: als Lernort, Familientreffpunkt, Informationszentrum, Schatzkammer, Raum für Konzentration, Zeit(reise)maschine und vieles andere mehr.
Dennoch - Bibliotheken zahlen sich aus. Wie viel ist ein Bibliotheksbesuch wert?
Was als nette Spielerei daherkommt, scheint bei näherem Hinsehen ideologisch ziemlich aufgeladen zu sein.
Es reiht sich ein in die Kostenaufstellung, welche Kassenpatienten bekommen, damit sie wissen, was ihre Behandlung "wert" ist und korrespondiert mit dem dummen Spruch "was nichts kostet, ist nichts wert".
Denn welche Botschaft sollen die BibliotheksbenutzerInnen aus dem Ergebnis dieser Berechnung der in Anspruch genommenen Dienste herauslesen?
Dass der Betrieb von Bibliotheken was kostet?
Vermutlich wissen das die meisten.
Dass die Finanzierung aus Steuergeldern erfolgt und aus den Benutzungsbeiträgen?
Scheint auch wenigen verborgen zu bleiben.
Und für diejenigen, die es doch noch nicht wissen, könnte eine große Tafel im Eingangsbereich mit einer detaillierten Aufstellung des Bibliotheksbudgets nützlich sein.
Am Besten im Verbund mit einer zweiten Tafel, auf dem die Budgets für andere Einrichtungen und kommunalen Events aufscheinen, die oft um ein Vielfaches höher sind.
Doch so etwas gäbe natürlich Ärger mit den Bibliotheksbetreibern.
Da ist es doch viel geschmeidiger, den BüchereibenutzerInnen vor Augen zu halten, wie gut das Land, die Kommune, zu ihnen ist, auf dass sie dankbar seien und ohne Mucks Verspätungs- und sonstige Gebühren berappen. Und auch sonst im Leben nie darauf vergessen, dass sie ein Kostenfaktor sind.
Nebenbei: die zugrunde liegenden Einheiten beim Bibliothekswertrechner gehen offenbar davon aus, dass die jeweiligen Benutzerinnen Robinsone seien, die als einzige die Bibliothek benutzen, denn es wird u.a. der volle Einkaufspreis der einzelnen Medien angerechnet. Auf diese Weise kommen natürlich ziemliche Summen zusammen, die völlig außer acht lassen, dass die Medien einem massiven Sharing unterworfen werden und die Bibliothek eben von Vielen benutzt wird.
Ein weithin bekannter und zeitweise sehr exzessiver Bibliotheksbenutzer hat sich einstens über solche "Robinsonaden" ziemlich abfällig geäußert und zu Recht lustig gemacht.
Unter dem Titel Digital oder geschlossen?: Die Bibliotheken der Zukunft sendet Bayern 2 am 30. Juli 08 um 18.05 ein Feature. Aus dem Vorbericht ist zu vermuten, dass es sich dabei vorwiegend um ein Pushen der Digitalisierung der Buchbestände bzw. um eine verstärkte Umorientierung auf die virtuelle Bibliothek gehen dürfte.
Um die "traditionellen" BibliothekarInnen nicht ganz zu entmutigen, wird ihnen großmütig ein Nischenplätzchen zugewiesen, sofern sie bereit sind, sich auch dorthin zu "mausern".
Aktivitäten werden aufgezählt, die - und viele andere noch dazu - in den meisten Bibliothekssystemen bereits längst State of the Art sind.
Wieder mal läßt sich der Eindruck nicht verwischen, dass hier jemand über die Zukunft der Bibliotheken redet, der über die Gegenwart wenig Ahnung hat:
Die Bibliothek als kulturelles Kraftwerk
Doch die digitalen Angebote allein werden nicht reichen, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Das haben auch viele Bibliotheken erkannt: Sie mausern sich daher von der reinen "Buchausgabestelle" zum "Kompetenzzentrum für lebenslanges Lernen", kooperieren mit Schulen, bieten literarische Krabbelgruppen für Mütter mit Kleinkindern an und sprechen mit Kursen für kreatives Schreiben Senioren an. Egal wie virtuell die Bibliothek von morgen also auch sein wird - der Ort selbst, die "gemauerte Bibliothek" verliert dadurch nicht an Bedeutung. Sie hat eine zweite Chance: als Ort der Begegnung und als "kulturelles Kraftwerk".
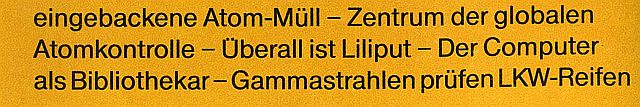
So steht es als Inhaltspotpourri auf der hinteren Coverseite von Peter Müller: Atome, Zellen, Isotope. Die Seibersdorf-Story. Und so beginnt das Kapitel über dieses Wunderding:
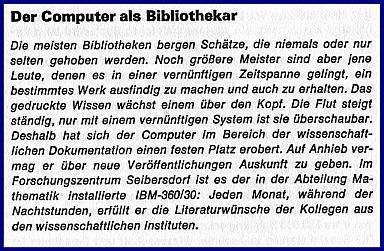
Der putzige Text aus dem Jahr 1977 erschien übrigens zeitnah zur Regierungskampagne für die Inbetriebnahme des fertiggestellten Kernkraftwerks Zwentendorf und hatte nicht zuletzt die Funktion, der "friedlichen Nutzung der Atomenergie" ein patriotisches Antlitz zu verpassen. Hat aber nicht so ganz hingehauen, denn bekanntlich wurde 1 Jahr später die Atomkraft als Energieproduzent von der österreichischen Bevölkerung verhindert.
Im Ensemble der österreichischen Nachkriegsmythen nimmt das "Forschungszentrum Seibersdorf der Österreichischen Studiengesellschaft für Atomenergie", das 1956 gegründet wurde, einen besonderen Platz ein: Neben der verstaatlichten Großindustrie und dem Wasserkraftwerksbau (Tauernkraftwerk) signalisierte dieses Forschungszentrum den Anspruch, im zukunftsträchtigen High-Tech-Bereich künftig eine Rolle spielen zu wollen; und Atomenergie war damals sehr sexy und das Mythen-Österreich stolz, auch einen, wenn auch kleinen Atomreaktor betreiben zu dürfen.
In Seibersdorf zu arbeiten, hatte ungefähr ein so hohes Sozialprestige wie beim Österreichischen Fernsehen oder bei der 1957 gegründeten UNO-Einrichtung IAEO angestellt zu sein. Nur Toni Sailer zu sein galt damals mehr.
Der Zustrom von Protektionskindern zu diesen Institutionen (bei Sailer warens die "guten Freunde") blieb nicht aus. Helmut Qualtinger lästerte dazu in Bronners Song "Der Papa wirds scho richtn":
Na wie ma so sitzen in der Eden und reden,
inzwischen war´s schon viertel, halber drei,
da sag´ ich - nachdem ich bißl grübel: "Gießhübl!
Ich hör´, Du hast a kleine Schererei?
In unseren Kreisen spricht man überall davon,
man hätte Dich einfach abgelehnt
für irgendein´ Job bei der Atomkommission
mit monatlich dreizehntausend Schlei als Lohn,
sie sag´n, Du wärst zu unintelligent!"
Da sagt der Gießhübel darauf: "Na klar,
a bissel was is´ schon d´ran wahr,
wann´s d´z´ruckdenkst noch an uns´re Schul,
da war ich eher schon a Null
Na und die Universität ...
Du kennst mi ja, das liegt mir net.
Drum war ich bisserl desperat
als man mich dort net g´nommen hat."
Drauf sag´ ich: "S´tät mich int´ressier´n
wirst Du da gar net protestiern?"
"Zu was", sagt er, "soll ich mich strapazier´n?
Der Papa wird´s schon richten, der Papa wird´s schon richten,
das g´hört doch zu Pflichten von jedem Herrn Papa.
Im Fall Seibersdorf presste die FPÖ während ihrer Regierungsbeteiligung ab 2000 so viele ihrer Versorgungsfälle vor allem aus dem burschenschaftlichen Bereich in dieses Forschungszentrum, dass es nach einiger Zeit am Rand der Zahlungsunfähigkeit war und radikale Maßnahmen notwendig waren, um es zu retten. Und bis in jüngste Zeit bedurfte es einigen Aufwands, diese Bande wieder loszukriegen.
Hat aber irgendwie nichts mehr mit dem "Computer als Bibliothekar" zu tun.
"Was will Fritz Dinkhauser?" fragte der ZIB2-Moderator in seinem B log, nachdem er vorher versucht hatte, das aus fritz the list himself herauszukriegen.
log, nachdem er vorher versucht hatte, das aus fritz the list himself herauszukriegen.
Die Antwort hat er dankenswerter transkribiert:
„Das, was wir gemeinsam brauchen, ist ein gerechtes Österreich. Wir merken, daß die soziale Dimension in diesem Land absolut verloren gegangen ist. Die Frage der Pflege – wir haben bis heute keine Lösungen. Wir haben im Bereich der Gesundheit keine Lösungen. Und ich kann Ihnen die Lösung natürlich anbieten. Das ist logisch. Es braucht natürlich eine Frage der Gerechtigkeit, eine Frage der Gerechtigkeit des Einkommens. Das heißt, wir haben natürlich keine Wunderdinge anzubieten, aber wir haben eine aufrechte und gerade und ehrliche Politik und da gibt’s natürlich auch viele Lösungen.“
Nach der Sitzung meinte fritz the list umgeben von einer knorrigen Männerrunde zur Entscheidung über eine bundesweite Kandidatur: "Eine Drillingsgeburt sei dagegen etwas Leichtes.". Die Mander da müssen es ja wissen.
In einer jener glücklichen Zweigstellen, die im Jahre 7 zum medialen Hochsicherheitstrakt ausgebaut werden sollten, befindet sich das CD-Regal gegenüber der Ausleihetheke, wodurch für eine unverbuchte Mitnahme dieser Medien ein gewisses Maß an Geschick und Kaltblütigkeit vonnöten ist. Der Abgang hält sich somit in Grenzen. Für die DVDs und CD-Roms wird ein Platzhaltersystem verwendet.
 Was natürlich sowohl hinsichtlich der Einarbeitung als auch bei der Ausleihe mehr Aufwand bedeutet; außerdem erhöhte Materialkosten durch die zusätzliche Hülle. Daher stand die Belegschaft der Bücherei vor der Entscheidung, ob nach der Transponderisierung des Medienbestands dieser zusätzliche Aufwand noch zu verantworten sei; denn die Einführung der RFID-Verbuchung ging zwar nicht mit einer Personalkürzung einher, doch durch die Erweiterung der Öffnungszeiten erfolgte naturgemäß eine Verknappung der Verwaltungsarbeitszeit.
Was natürlich sowohl hinsichtlich der Einarbeitung als auch bei der Ausleihe mehr Aufwand bedeutet; außerdem erhöhte Materialkosten durch die zusätzliche Hülle. Daher stand die Belegschaft der Bücherei vor der Entscheidung, ob nach der Transponderisierung des Medienbestands dieser zusätzliche Aufwand noch zu verantworten sei; denn die Einführung der RFID-Verbuchung ging zwar nicht mit einer Personalkürzung einher, doch durch die Erweiterung der Öffnungszeiten erfolgte naturgemäß eine Verknappung der Verwaltungsarbeitszeit.
Für die Auflassung des Platzhaltersystems sprach, dass es kontraproduktiv wäre, wenn die BenutzerInnen - vor allem in der Umgewöhnungsphase auf die Selbstverbuchung - bei einer DVD-Ausleihe erst recht wieder das Büchereipersonal in Anspruch nehmen müssten. Da vermutlich die Arbeitsersparnis durch Selbstverbuchung und Stapelausleihe vor allem in den ersten Monaten nicht so groß sein werde, dass damit die längere Öffnungszeit kompensiert würde, könne man sich keine "Luxusarbeiten" mehr leisten.
Dem wurde entgegengehalten, dass die Erfahrungen in der Hauptbücherei im Hinblick auf die Sicherung der audivisuellen Medien nicht so toll seien und es wäre schade, wenn der mühsam erkämpfte DVD-Bestand vor der Zeit schmelze.
Dem wurde - vor allem auch von der Leitung der Wiener Büchereien - entgegengehalten, was sechs Monate später Jenny Oltersdorf in ihrer Magisterarbeit hinsichtlich der geringeren Kontrollierbarkeit von Beschädigungen bei automatisierter Rückgabe schreibt:
"damit der Bestand in Öffentlichen Bibliotheken nicht veraltet, sollten jährlich 10 Prozent des gesamten Medienangebotes erneuert und entsprechend veraltete oder beschädigte Medien makuliert werden. Dadurch wird der Bestand Öffentlicher Bibliotheken ... in regelmäßigen Abständen vollständig ausgewechselt" (S. 30)
Dem wurde entgegengehalten, dass es nicht leicht fallen werde, Langfinger ausschließlich auf die regelmäßige Entwendung veralteter oder beschädigter Medien zu konditionieren, um eine Erneuerung und nicht Veralterung des Bestands zu gewährleisten.
Das Thema Arbeitsbelastung wurde schließlich durch ein Mitglied der Leitung mit der launig hingeworfenen Bemerkung fokussiert: "Dann kommts aber ned her und jammerts, dass ihr so viel Arbeit habts!" Diese wohl unbeabsichtigte paradoxe Intervention gab den Ausschlag: das Platzhaltersystem wurde beibehalten.
Die darauf folgenden Erfahrungen waren unspektakulär: es gab keinen auffallenden Medienschwund, sondern nur zahlreiche Fehlalarme beim Verlassen und Betreten der Bücherei, die Manipulationen mit den Platzhaltern machten weniger Arbeit als die Versuche, die audivisuellen Medien zu verbuchen bzw. die BüchereibenutzerInnen in den Selbstverbuchungsfrust zu jagen.
Zusammenfassend kann man sagen, dass sich bezüglich des Mediensicherungsaspekts nichts geändert hat. Mit einer Ausnahme: wenn in präelektronischen Sicherungszeiten jemand mit einem großen Buch oder mehreren Medien an der Ausleihetheke vorbei dem Ausgang zustrebte, dann musste er damit rechnen gefragt zu werden, ob die Medien schon verbucht seien. Solche Belästigung entfällt nunmehr, da davon auszugehen ist, dass das Sicherungsgate ungefragt eine Antwort gibt.
Bei unlauteren Absichten und bei minimalen Kenntnissen, die in wenigen Minuten ergoogelt werden können, bleibt aber auch das Gate stumm.
Womit die Chance steigt, dass gegenüber früher nunmehr eher umfangreichere Werke ihr Oneway-Ticket in die privaten Haushalte lösen und damit das Platzproblem in der Bücherei zwar nicht gelöst, aber deutlich entschärft werden kann.
Bisher zum Thema:
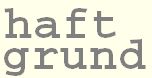

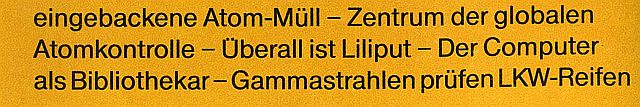
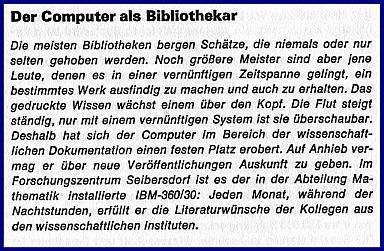

 Was natürlich sowohl hinsichtlich der Einarbeitung als auch bei der Ausleihe mehr Aufwand bedeutet; außerdem erhöhte Materialkosten durch die zusätzliche Hülle. Daher stand die Belegschaft der Bücherei vor der Entscheidung, ob nach der Transponderisierung des Medienbestands dieser zusätzliche Aufwand noch zu verantworten sei; denn die Einführung der RFID-Verbuchung ging zwar nicht mit einer Personalkürzung einher, doch durch die Erweiterung der Öffnungszeiten erfolgte naturgemäß eine Verknappung der Verwaltungsarbeitszeit.
Was natürlich sowohl hinsichtlich der Einarbeitung als auch bei der Ausleihe mehr Aufwand bedeutet; außerdem erhöhte Materialkosten durch die zusätzliche Hülle. Daher stand die Belegschaft der Bücherei vor der Entscheidung, ob nach der Transponderisierung des Medienbestands dieser zusätzliche Aufwand noch zu verantworten sei; denn die Einführung der RFID-Verbuchung ging zwar nicht mit einer Personalkürzung einher, doch durch die Erweiterung der Öffnungszeiten erfolgte naturgemäß eine Verknappung der Verwaltungsarbeitszeit.